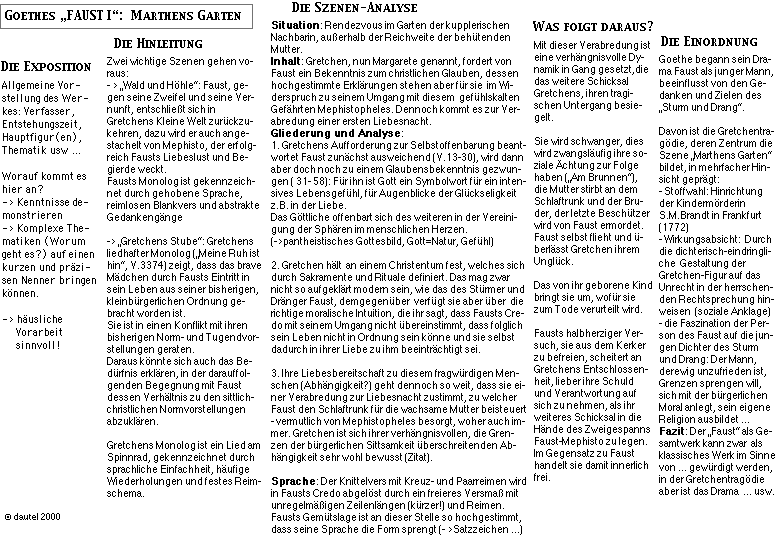Goethe, Schiller und Zeitgenossen
K. Dautels Ideen, Materialien, Vorschläge für den Deutschunterricht
Die Materialien stehen unter der Creative Commons Lizenz: BY 4.0.
|
|
Übersicht |
Die Gretchen-Frage (Beispiel für eine Szenen-Analyse in 5 Schritten)
I. Die Exposition: Kurzvorstellung
Kurzcharakteristik des Werkes: Verfasser, Entstehungszeit, Hauptfigur(en), Thematik usw ...
Worauf kommt es hier an?
II. Die Hinleitung: Was geht möglichst unmittelbar voraus
Zwei wichtige Szenen gehen voraus:
Gretchens Monolog ist ein Lied am Spinnrad, gekennzeichnet durch sprachliche Einfachheit, häufige Wiederholungen und festes Reimschema.
III. Die Szenen-Analyse: Das Wo, Wer und Wie der Szene
Ort und Situation:
Inhalt:
Gretchen, nun Margarete genannt, fordert von Faust ein Bekenntnis zum christlichen Glauben. Dessen hochgestimmten Erklärungen stehen aber für sie im Widerspruch zu seiner Beziehung zu diesem gefühls-kalten Gefährten Mephistopheles. Dennoch kommt es zur Verabredung einer ersten Liebesnacht.Gliederung und Analyse:
1. Gretchens Aufforderung zur Selbstoffenbarung beantwortet Faust zunächst ausweichend (V.13-30), wird dann aber doch noch zu einem Glaubensbekenntnis gezwungen ( 31- 58): Für ihn ist Gott ein Symbolwort für ein intensives Lebensgefühl, für Augenblicke der Glückseligkeit z.B. in der Liebe. Das Göttliche offenbart sich des weiteren in der Vereinigung der Sphären im menschlichen Herzen. (→ pantheistisches Gottesbild, Gott = Natur etc)
2. Gretchen hält an einem Christentum fest, welches sich durch Sakramente und Rituale definiert. Das mag zwar nicht so aufgeklärt modern sein, wie das des Stürmer und Dränglers Faust, demgegenüber verfügt sie aber über die richtige moralische Intuition, die ihr sagt, dass Fausts Credo mit seinem Umgang nicht übereinstimmt, dass folglich sein Leben nicht in Ordnung sein könne und sie selbst dadurch in ihrer Liebe zu ihm beeinträchtigt sei.
3. Ihre Liebesbereitschaft zu diesem fragwürdigen Menschen geht dennoch so weit, dass sie einer Verabredung zur Liebesnacht zustimmt, zu welcher Faust den Schlaftrunk für die wachsame Mutter beisteuert - vermutlich von Mephistopheles besorgt. Gretchen ist sich ihrer verhängnisvollen, die Grenzen der bürgerlichen Sittsamkeit überschreitenden Abhängigkeit sehr wohl bewusst (→ Zitat).
Sprache:
Der Knittelvers mit Kreuz- und Paarreimen wird in Fausts Credo abgelöst durch ein freieres Versmaß mit unregelmäßigen Zeilenlängen und Reimen.
Fausts Gemütslage ist an dieser Stelle so hochgestimmt, dass seine Sprache die gereimte Form sprengt (unterschiedliche Zeilenlänge, unvollständige Satz-Syntax, gehäufte Satzzeichen).
Gretchens Sprechweise ist demgegenüber direkt, bestimmt und fordernd
IV. Was folgt daraus? Warum ist diese Szene handlungsrelevant?
Mit dieser Verabredung ist eine verhängnisvolle Dynamik in Gang gesetzt, die das weitere Schicksal Gretchens, ihr „tragisches” Ende besiegelt.
Sie wird schwanger, dies wird zwangsläufig ihre soziale ächtung zur Folge haben („Am Brunnen“),
die Mutter stirbt an dem Schlaftrunk und der Bruder, der letzte Beschützer wird von Faust ermordet.
Faust selbst flieht und überlässt Gretchen ihrem Unglück.
Das von ihr geborene Kind bringt sie um, wofür sie zum Tode verurteilt wird.
Fausts halbherziger Versuch, sie aus dem Kerker zu befreien, scheitert an Gretchens Entschlossenheit, lieber ihre Schuld und Verantwortung auf sich zu nehmen, als ihr weiteres Schicksal in die Hände des Zweigespanns Faust-Mephisto zu legen.
Im Gegensatz zu Faust handelt sie damit innerlich frei.
V. Die Einordnung: Der literaturgeschichtliche, zeitgeistige, biografische Kontext
Goethe begann sein Drama Faust als junger Mann, beeinflusst von den Gedanken und Zielen des „Sturm und Drang“. Davon ist die Gretchentragödie, deren Zentrum die Szene „Marthens Garten“ bildet, in mehrfacher Hinsicht geprägt:
Fazit: Der „Faust“ als Gesamtwerk kann zwar als klassisches Werk im Sinne von ... gewürdigt werden, in der Gretchentragödie aber ist das Drama durch und durch „Sturm & Drang" usw.