Goethe, Schiller und Zeitgenossen
K. Dautels Ideen, Materialien, Vorschläge für den Deutschunterricht
Die Materialien stehen unter der Creative Commons Lizenz: CC BY 4.0.


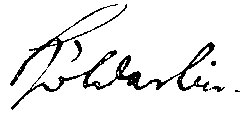
Übersicht Hälfte des Lebens Eichbäume Hyperion
Die beiden Strophen erschienen zuerst im ‘Taschenbuch für das Jahr 1805’ zusammen mit acht anderen Gedichten Hölderlins unter dem Titel ‘Nachtgesänge’. Die Entstehung des Gedichtes reicht ein paar Jahre zurück, so dass das Veröffentlichungsjahr nicht das Jahr ist, in dem es verfasst wurde. Dieser Umstand ist wichtig, um vorschnelle biografische Schlussfolgerungen zu vermeiden. Die ersten Rezensenten des Gedichten sahen nämlich wegen dieser späten Veröffentlichung schon Grund für die Annahme, dass in dem Gedicht bereits Spuren von Hölderlins Wahnsinns zu finden seien.
Charakteristisch für das Gedicht ist der unversöhnt bleibende Gegensatz, sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Der harmonisch geschlossenen Form und Bilderwelt der ersten Strophe steht die Zerrissenheit der zweiten Strophe gegenüber, dort sind die Zeilenlängen unregelmäßig, die Zeilen stehen mit der Satzgrammatik im Konflikt.
Gegenüber der sich selbst genügenden Natur in der ersten Strophe ist das lyrische Ich rein beobachtend. Es hat an dieser Harmonie keinen Anteil, es befindet sich außerhalb der geschauten Harmonie.
Des Weiteren ist diese Szenerie nicht als „Sommer” zu verstehen, dazu passen die gelben Birnen nicht so richtig. Diese Szenerie zeigt vielmehr eine Natur in ihrer Vollendung und Reife, also einen Naturzustand und keine Jahreszeit.
Hierfür sind auch die gehäuften Adjektive verantwortlich, welche in der zweiten Strophe fast gänzlich wegfallen.
Die elegische Selbstreflexion in der zweiten Hälfte des Gedichtes drückt demgegenüber das Gefühl äußerster Vereinsamung aus, die Dinge sind zu Zeichen erstarrt, die nichts bedeuten, nur Kälte und Starre ausstrahlen. Das lyrische Ich weiß nicht, wie es zur Welt steht, es ist auf sich selbst zurückgeworfen und verloren in seiner Grund-losen Existenz.
Das Gedicht versucht nicht, die Trennung von Welt und Ich in einer höheren Idee aufzuheben, vielmehr wird die existentielle Heimat- und Ratlosigkeit des Menschen als Daseinsbefund offen gelassen. Darin steht das Gedicht außerhalb der ästhetischen Norm seiner Zeit: Es zeigt nicht jene Autonomie der Kunst gegenüber einer schlechten Wirklichkeit, von der aus dem Künstler die Versöhnung von Ideal und Leben im Reiche des ästhetischen Schein gelingt.
Das lyrische Ich bleibt stattdessen im schmerzlich Empfundenen stecken, eine dritte Strophe, die diese Antithetik auflösen könnte, gibt es nicht. Dies kann auch die Ratlosigkeit zeitgenössischer Rezensenten dem Gedicht gegenüber erklären. (→ siehe Rezeptionsdokumente>



Zur Rezeption : Das Gedicht und seine ratlosen Leser
(als Textblatt (pdf) zum Download)
Die ersten Reaktionen auf die Veröffentlichung der Gedichtsammlung >Nachtgesänge<, welche „Hälfte des Lebens” enthält, sind aus dem Jahre 1805 und klingen so:
"Die Gedichte von Hölderlin (...) sind Wesen eigener Art und erwecken ganz vermischte Gefühle. Es scheinen abgerissene Laute eines gestörten einst schönen Bundes zwischen Geist und Herz. Daher auch die Sprache schwerfällig, dunkel, oft ganz unverständlich und der Rhythmus eben so rauh."
"Für den seltenen Sterblichen, der die neun Gedichte von Hölderlin zu verstehen sich mit Recht rühmen kann, sollte ein stattliche Preis ausgesetzt werden, und wir würden selbst den Verfasser nicht von der Mitbewerbung ausschließen."
(Hölderlin, Sämtliche Werke. Hrsg. von Friedrich Beißner Bd. 7,4 Stuttgart 1951 S.22/3)
Auch die Freunde und Verehrer Hölderlins können diese Gedichte nicht recht einordnen. Christoph Theodor Schwab, der 1846 die >Sämtlichen Werke< Hölderlins herausgibt, schiebt "Hälfte des Lebens" in das Kapitel mit der Überschrift "Aus der Zeit des Irrsinns" ab. Der Makel des Irrsinns verfolgt den Text nun für die nächsten 100 Jahre!
Alexander Jung 1848:
" In einfachen, fast nur skizzenhaft, fast kinderspielartig, aber doch malerisch hingeworfenen Zügen veranschaulicht uns der Dichter das Gesagte in den vorliegenden beiden Strophen. So könnte dieses Gedicht als das Erzeugniß eines völlig gesunden wunderbar fein und so zu sagen das Dingliche wie sein eigenes Gemüthsleben empfindenden Zustandes betrachtet werden."
(Friedrich Hölderlin und seine Werke, Stuttgart und Tübingen 1848 S. 274)
Wilhelm Dilthey 1905:
"Wenn der erworbene Zusammenhang des Seelenlebens, wie er an die Funktionen des Gehirns gebunden ist, zu versagen beginnt, dann erhält die Gestaltung der einzelnen bilder eine eigene Unabhängigkeit und Energie. Ideen möglicher Wirkungen treten aus dem Rahmen der festgefügten Bedingungen einheitlicher Kunstform heraus. Unreguliert gehen Gefühl und Phantasie ihre exzentrische Bahn (...) seine Sprache geht in ihrer bildlichen Stärke bis zu Seltsamen und Exzentrischen. Es ist darin eine eigene Mischung von krankhaften Zügen mit dem Gefühl des lyrischen Genies für einen neuen Stil. Ein paar Zeilen haben sich erhalten, die wohl Bruchstücke eines größeren Ganzen waren, eine flüchtige Niederschrift mit manchen Inkorrektheiten; sie mögen doch diese Richtung Hölderlins zu einer neuen lyrischen Sprache vergegenwärtigen."
(Das Erlebnis und die Dichtung, Göttingen 1957 S.289/90
Dr. med Wilhelm Lange1909:
"Das Kranke an diesen Versen kann wohl nur von solchen, die täglich mit Katatonischen umzugehen haben, gleichsam gefühlsmäßig erfaßt werden. Das Ganze steht da als ein imposanter Ausdruck der Vereinsamung; seine Umgebung erschien dem Kranken fremd und rückte in eine unheimliche, unfassbare Ferne. Die Unfähigkeit zur Abstraktion liess den Kranken am unmittelbaren sinnlichen Eindruck haften.." (Hölderlin - Eine Pathographie, Stuttgart 1909 S. 120/1)
Kommentar: Bis weit ins 20. Jahrhundert prägt das biographische Faktum der Verrücktheit
des Autors die Rezeption dieses Gedichtes. Immer stärker drängt sich die Kunde vom
Wahnsinnigen im Turm zwischen Text und Leser und drückt der Lektüre ihren Stempel
auf, funktioniert somit als Sinn-gebendes als Vor-Urteil.
Erst in den 20er Jahren stellt sich heraus, dass die Entstehungszeit des Gedichtes
bisher falsch datiert war. Es entstand nicht nach 1800, sondern als "Nebenprodukt"
einer größeren Hymne ("Wie wenn am Feiertage"), die auf das Jahr 1798 datiert werden kann. Zu diesem Zeitpunkt darf Hölderlins Geisteszustand noch als "normal" bezeichnet werden.
Warum haben diese gelehrten Ärzte und Wissenschaftler aber in diesem Gedicht so deutliche
Spuren des Wahnsinns gesehen? Welchen ästhetischen Normen widersprach es, welche
inhaltlichen Erwartungshaltungen der zeitgenössischen Lyrikleser wurden hier so herb
enttäuscht?
Abschließend eine ganz andere Stimme, die von Marie Luise Kaschnitz, welche Hölderlins Gedicht vor dem Hintergrund eigener Lebenserfahrung liest und darin sich selber immer neu wiederfindet:
"Als ich (Hölderlins „Hälfte des Lebens”) kennenlernte, war ich beinahe noch ein Kind. (...) Die Landschaft, die ich beim Lesen der ersten Strophe vor Augen hatte, die des Bodensees nämlich mit ihrer nachsommerlichen Fülle von Blumen und Früchten, beglückte mich, das winterliche Bild der sprachlosen Mauern erregte in mit eine Wollust der Einsamkeit, das Klirren der Drähte an den leeren Fahnenstangen war dazu die passende Musik.
Erst in späteren Jahren verstand ich recht eigentlich die schmerzliche Frage und Klage des Gedichts, ich bezog sie auf das Alter, das jedem jungen Menschen als einhalber Tod erscheint und dessen Schrecken ich durch die Vision einer nicht mehr von Blumen und schönen Tieren belebten, grauen Winterlandschaft vollkommen ausgedrückt fand.
Noch später las ich das Gedicht wieder anders, nämlich als tödliche Furcht vor einem krankhaften und doch auch jedem gesunden Menschen bekannten Seelenzustand der inneren Verödung und Kälte, in dem die Dinge ihre Farben, ihren Duft und ihre Stimme verlieren. Diese Furcht vor einer ewigen, nur von kalten metallischen Geräuschen noch erfüllten Gefühllosigkeit weiß der Dichter, der vorher die Liebestrunkenheit und die heilige Nüchternheit seines lebendigen Lebens in so herrlichen Bildern darstellte, auch im Leser und Hörer zu erwecken, nicht nur durch die Wahl seiner Worte, sondern auch durch die Folge seiner Vokale ..."
M.L.Kaschnitz: Mein Gedicht, in: Zwischen Immer und Nie, Essays 1971