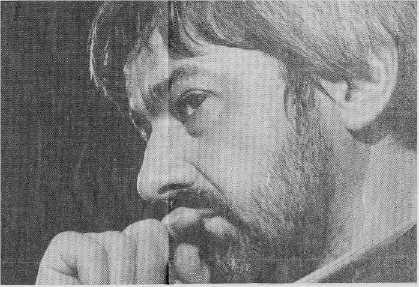Jurek Becker: Bronsteins Kinder (1986)
Die Handlung spielt
- in Ost-Berlin,
- im Sommer 1973, in welchem der Vater des Ich-Erzählers "zu Schaden kam", d.h. er starb,
- und im Sommer 1974, von dem aus die Ereignisse erzählt bzw. rekapituliert werden (eingerückt dargestellt).
- Äußere Begebenheiten sind die "Weltfestspiele der Sozialistischen Jugend" in Ost-Berlin 1973, Walter Ulbrichts Tod und Willy Brandts Rücktritt 1974.
Zitiert wird nach der Ausgabe des Suhrkamp Verlags Frankfurt
(7) Der Roman beginnt mit einem Rückblick vom Sommer 1974 auf den Sommer 1973: Der Ich-Erzähler Hans Bronstein ist nach dem Tod seines Vaters am 4. August 1973 Vollwaise. Jetzt ist das Trauerjahr fast abgelaufen, er wohnt noch bei der Familie seiner ehemaligen Freundin Martha Lepschitz, hat das väterliche Haus verkauft, das Abitur hinter sich und wartet nun auf den Beginn seines Philosophie-Studiums. Seine zehn Jahre ältere Schwester Elle lebt in der Irrenanstalt. Der Tod des Vaters, vor allem dessen Umstände, haben den jungen Mann aus dem Gleichgewicht gebracht, und er glaubt, um die Ereignisse vergessen zu können, sie zunächst einmal genau erinnern zu müssen.
(16) An einem Sonntag im Sommer 1973 möchte Hans (18) sich mit seiner Freundin Martha im väterlichen Sommerhäuschen, einer geräumigen Waldhütte treffen. Er hat einen Nachschlüssel, der Vater soll davon nichts wissen. In der Hütte findet er aber seinen Vater, dessen Kameraden Gordon Kwart und einen Unbekannten, die einem gefesselten, ebenfalls älteren Mann mit Gewalt ein Geständnis abzuzwingen versuchen. Er war Aufseher im Lager Neuengamme gewesen. Die drei Alten sind über Hans Erscheinen ratlos. Sie haben jetzt einen unerwünschten Mitwisser. Hans verlässt das Haus, um zu verhindern, dass Martha zufällig hereinkommt. Statt in das Haus gehen sie ins Kino.
(31) Am nächsten Tag steht noch eine Schwimmprüfung fürs Abi an. Hans kann nicht schlafen und denkt über die Entdeckung nach. In einem Lexikon hat er über das KZ Neuengamme nachgelesen. Was war in die Alten gefahren, seinen sonst nie zornigen Vater oder den langweiligen Orchestergeiger Kwart, dass sie nun glauben das Recht in ihre Hand nehmen zu müssen?
- (36) Sommer 1974: Im Briefkasten der Lepschitz findet Hans einen Brief seiner Schwester Elle. Sie lebt in der Anstalt, weil sie hin und wieder aus unerklärlichen Gründen wildfremde Erwachsene angreift. Dieser Brief ist nicht für Hans sondern für Martha. Das verwirrt ihn. Seine ehemalige Freundin, die jetzt eine Schauspielschule besucht, will ihm den Brief zwar vorlesen, aber nicht zeigen.
(40) Montag: Nach der Schwimmprüfung im Duschraum vergisst Hans die Badehose auszuziehen, einem Jungen, der ihn dreimal darauf aufmerksam macht, schlägt er plötzlich ins Gesicht, es kommt zum Tumult. Als er später, vom Lehrer dazu aufgefordert, sich beim Opfer entschuldigt, stellt sich öberraschendes heraus: Der Vorfall ist vom Lehrer damit erklärt worden, dass Hans Jude sei und deswegen empfindlich, was sein beschnittenes Glied angeht. Er ärgert sich, denn jetzt ist ihm eine Rolle zugewiesen worden, die er nicht haben will und mit deren Implikationen er sich nicht identifizieren kann: Die Rolle des Juden und damit Opfers, an dem etwas wiedergutzumachen ist.
- (50) Er erhält die Zulassung zum Studium. Im Gespräch mit den Lepschitz stellt sich heraus, dass er an diesem Studium nicht sehr interessiert ist, dass er desweiteren als Angehöriger eines Opfers des Nazi-Regimes gewisse Vergünstigungen hat (zu seinem Ärger) und dass er bei den Lepschitz nicht mehr so gut gelitten scheint, wie noch als angehender Schwiegersohn (im Fernsehen wird die Nachricht vom Rücktritt Willy Brandts gesendet).
(57) Besuch bei der Schwester: Direkt vom Schwimmbad aus fährt er zu seiner Schwester, in der Hoffnung, mit dieser die Sache besprechen zu können. Von einem neuen Arzt erfährt er, dass Elle gerade wieder eine Besucherin angegriffen habe, er selbst hat auch Kratzspuren am Hals. Elle steht noch unter den Einwirkungen der Beruhigungsspritze, als Hans zu ihr gelassen wird. Er hat ein sehr enges, respektvolles Verhältnis zu ihr, seiner großen Schwester, von ihr erhofft er - trotz allem - den entscheidenden Rat. Der aber bleibt aus.
(69) Montag: Am Abend dann das erste Gespräch mit dem Vater: Die beiden belauern sich wie Kontrahenten, es wird nicht offen gesprochen, Hans lügt und der Alte versucht ihn einzuschüchtern (Analyse des Gesprächs!). Wütend verlässt er das Haus. Einen Telefonanruf von Herrn Rotstein (der Fremde im Waldhaus) nimmt Hans zum Anlass, seinen Vater in seiner Stammkneipe aufzusuchen. Nach anfänglicher Feindseligkeit gibt es eine Annäherung. In einem Park kommt es zur Annäherung: Sie lebten in einem "minderwertigen Land" (80), dass der Aufseher in der DDR hart bestraft würde, sei reiner Zufall, woanders könne es anders ausgehen. Demgegenüber argumentiert Hans damit, dass niemand das Recht habe sich, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, dann verletze man doch Gesetze. Das beeindruckt den Vater nicht.
Beispiel einer Textanalyse (Klausuraufgabe)
- (83) Im Hause Lepschitz ist der Fernseher kaputt. Man spricht über Vitamin-Tabletten. Hans Gedanken wandern zurück zum Vater, und ob er dessen Tod hätte verhindern können. Aber so ist er nicht erzogen worden.
Hans blickt zurück auf seine Kindheit allein mit dem Vater. Er empfindet ein Defizit (86/7), weil er nichts zu "seiner Sache" gemacht hat. Tatsächlich ist er unentschlossen, indifferent, als das Gespräch auf die Perspektiven seines Philosophie-Studiums kommt, fällt ihm nichts dazu ein, auch dass Martha mit einem anderen ausgeht, reizt nicht seinen Kampfeswillen.
(91) Dienstagmorgen, letzter Prüfungstag: Gleich nach der Prüfung fährt Hans zur Waldhütte. Der seit fünf Tagen gefesselte Mann heißt Arnold Heppner. Er sagt er werde geschlagen, am meisten von Hans Vater, er habe schon tausendmal bereut, und bietet Hans 6000 Mark für eine Befreiung an.
(107) Am Nachmittag geht er direkt zu Martha, diese präsentiert ihm stolz ein Drehbuch für einen Film , in dem sie eine hübsche Jüdin in einer Widerstandsorganisation spielen soll. Er ist nicht begeistert und wittert Unheil.
- (114) Hans beginnt mit Wohnungssuche. Martha borgt sich von ihm Geld für ein Geburtstagsgeschenk. Hugo Lepschitz wird 60. Er schlägt vor, gemeinsam etwas zu kaufen. Er weiß natürlich nichts, er weiß aber auch nicht, wie er jetzt zu Martha steht. Er kann sich nicht zu Taten durchringen.
(121) Ein Brief von ELLE: Sie schreibt sehr Vernünftiges über Hans Charakter, aber auch Rätselhaftes über ein gestohlenes Bild.
(125) Vater kommt herein, liest den Brief und stellt fest, dass Elle ihm nie schreibe. Es ergibt sich ein zweites Gespräch zum Thema: Die Deutschen hätten keine öberzeugungen, deshalb hätten sie auch kein Recht, über solche Leute wie Heppner Recht zu sprechen.
(132) Hans besucht am Abend Gordon Kwart in der Hoffnung, mit ihm über die Sache sprechen zu können. Dieser aber, dessen Frau und Töchter vor Jahren nach Israel verschwunden sind, erweist sich als härterer Brocken als erwartet. Er war es gewesen, der hinter Heppners Vergangenheit gekommen war und ihn dann ins Häuschen gelockt hatte. Er lässt auch nicht mit sich reden.
- (141) Hans fährt mit der Straßenbahn in seine alte Wohngegend. Seine Gedanken kreisen um Frauen, als "Ansammlung verschiedener Körperteile". Das sieht er Martha mit einem Herrn, steigt aus und folgt ihnen. Sie begegnen sich, ein flüchtiger Gruß wird gewechselt.
(149) Freitag nach dem Frühstück: Er besucht "seinen Halbfreund" Ernst Klee und bittet um dessen Schreibmaschine für einen anonymen Brief. Er findet die Idee dann aber nicht mehr gut und geht. Dann erinnert er sich daran, dass der Vater von Gitta Seidel Rechtsanwalt sei. Er trifft sich mit ihr, diese jedoch ist empört, als sie sein wirkliches Anliegen hört.
- (156) Samstag: Hans besucht Elle. Sie zeigt ihm den "Mittelpunkt der Erde" und fragt ihn nach ihrem Anteil am väterlichen Erbe.
(164) Berlin, Weltfestspiele der Jugend. Hans und Martha gehen im Getümmel der Gäste spazieren. Hans bringt es nicht fertig, ihr sein Problem zu offenbaren, obwohl sie schon längst gemerkt hat, dass seit dem Sonntag (fünf Tage) etwas nicht stimmt. Was war da in der Hütte geschehen?
- (171) Nach dem Besuch bei Elle geht Hans zu Gordon Kwart, um dessen Mithilfe bei der Zimmersuche zu erbitten. Kwart offenbart Hans gegenüber sein schweres Gewissen wegen Vaters Tod, er fühlt dei Mitschuld schwer auf ihm lasten - doch solche Empfindungen sind Hans fremd, er will ein Zimmer, während Kwart sein Gewissen erleichtern will. Kwart bietet ihm ein kleines Zimmer ins einer Wohnung an, das hans aber unter keinen Umständen haben will. (GENERATIONENDIFFERENZ : praktisch <-> moralisch)
(181) Kwart lädt Hans und seinen Vater zu einem Essen ein (DDR-Gastronomie), doch anstatt zur Klärung oder Versöhnung kommt es zu fortgesetzten Feindseligkeiten zwischen Vater und Sohn. Kwart kann nicht vermitteln und die Situation bleibt offen. Hans erfährt dabei, dass der Gefangene zu fliehen versucht hat, sich dabei jedoch einen Fuß verstauchte.
(191) Montag: Zweiter Brief von Elle mit dem Rat, sich nicht mehr um Vaters Angelegenheiten zu kümmern.
(195) Hans besucht Martha im Filmstudio und beobachtet die Dreharbeiten zu dem Film, in dem es um den Widerstand der Juden im Dritten Reich geht. Immer wieder muss er an Elles Brief denken, Er ist sich nun sicher, dass sein Vater von Hans Besuch bei Elle weiß und ihm dafür böse ist, denn er will Elle vor der Außenwelt verschonen.
- (204) Kwart ruft an, er hat noch kein Zimmer gefunden, aber er solle doch mal zum Büro für die Opfer des Faschismus gehen, die haben ihm schon oft geholfen. Hans weigert sich. - Er erzählt Martha von seinen Auszugsplänen, sie protestiert nicht.
(210) Nach den Dreharbeiten 'entführt' ihn Martha mit einem Taxi an einen See, wo ihr Onkel ein Motorboot hat, zu dem sie den Schlüssel erbettelt hat. Es gelingt Hans für ein paar Stunden, seine Probleme zu vergessen.
(218) Zuhause angekommen, kurz vor Mitternacht, belauscht er Vater, Kwart und Rotstein, wie sie sich auf Jiddisch Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. . Vater erzählt Elles Geschichte. Hans lässt das kalt.
- (224) Martha hat sich beim Tennisspielen mit ihrem Verehrer die Hand verstaucht. Hans macht das nichts mehr aus, er ist stimmungsmäßig auf dem Tiefpunkt: Langeweile, Antriebslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Gefühllosigkeit.
(231) Mittwoch 31.Juli: Hans besucht Elle und macht ihr Vorwürfe, weil sie Vater alles erzählt hat, weil er so ratlos ist und weil Vater gesundheitlich am Ende zu sein scheint. Sie verweigert ihm aber den Rat, sie sprechen aneinander vorbei.
(240) Hans kehrt heim. Er stellt fest, wie verwahrlost inzwischen die Wohnung ist. Beim Aufräumen in Vaters Zimmer findet er Heppners Brieftasche (Jhg. 1907, sechs Jahre älter als Vater), die jedoch nichts Wichtiges enthält. Hans ist wütend über das Ausmaß der Unordnung, zertrümmert eine Tasse und legt ein Bild aus Heppners Brieftasche in Vaters Kiste mit Familienfotos. Vater kommt nach Hause. Er will wissen, ober er mit Elle wieder über den Fall gesprochen habe. Die Beziehung scheint nun voller Feindschaft, jeder ist schonungslos. Darüber macht sich jetzt Hans große Vorwürfe.
(246) Der Erste des Monats, Vater hat Hans Wirtschaftsgeld gegeben, dafür putzt er die Küche. Am Abend bei Martha im Zimmer unternimmt er einen weiteren halbherzigen Versuch, sie in sein Problem einzuweihen, sie werden jedoch mehrfach von Frau Lepschitz unterbrochen (Walter Ulbricht gestorben) und außerdem hört Martha nicht so recht zu. Eine gewisse Fremdheit ist spürbar.
- (254) Obwohl er noch kein Zimmer hat, fängt er an zu packen. Dabei fällt ihm das Heft mit Heppners Daten ein. Er zerreißt es.
(257) Er geht in Heppners Straße, findet aber kein Namensschild mehr. Er gerät in die Wohnung eines Taubstummenpaares, von dem er erfährt, dass Heppner von einer Rentnerreise in den Westen nicht mehr zurückgekehrt sei. Zuhause findet er in Vaters Papieren heraus, dass dieser nach dem Kriege vergeblich versucht hatte, von den DDR-Behörden die Erlaubnis für einen Foto-Laden zu erhalten.
(263) Mitten in der Nacht wird Hans vom Lärm seines Vaters geweckt. Er ist betrunken und versucht zu essen. In Vaters Zimmer kommt es zum Gespräch: Dies sei ein 'guter Tag', der Aufseher habe gestanden, Erschießungen 'gesehen' zu haben. Er habe ihnen gedroht, dass er an Herzschwäche sterben könnte, wenn er keine bestimmte Medizin bekäme. Sie hätten sich davon nicht beeindrucken lassen.
(271) Er bringt den Betrunkenen ins Bett und streift dann ziellos durch die von Weltfestspielgästen gefüllte Innenstadt. Er geht nach Köpenick, wo eine Nachtszene zu Marthas Film gedreht wird. Martha bringt ihn zu sich nach Hause, wo er seinen Rausch ausschläft und am Morgen davonschleicht.
(281) Elles dritter Brief: Er überschätze sie, wenn er Rat erwarte und er solle Vater nicht 'in den Arm fallen'.
- (285) Martha hat ein Zimmer in einer Wohnung für ihn, er muss sich nur vorstellen. Sie bietet an, ihn zu begleiten. Die Fahrt dorthin verdeutlicht noch einmal die Fremdheit zwischen den beiden, besser: Hans' Indifferenz.
(293) Am nächsten Tag kauft Hans zwei Feilen, um den Gefangenen zu befreien. Am Abend fährt er zur Waldhütte, tausend Gedanken gehen ihm, dem 'Zögerer' (295) dabei durch den Kopf. Er wartet im Wald die Nacht ab, geht dann zum Haus, dort brennt noch Licht. Im Zimmer findet er neben dem Bett des Gefangenen auf dem Boden seinen Vater tot daliegen. Er setzt ihn hin und fängt an zu feilen, schafft es aber nicht, bis er in Vaters Tasche den Schlüssel findet.
Zentrale für Unterrichtsmedien (ZUM e.V.) - Klaus Dautel 1999/2006 (cc)

Ohne ein bisschen Werbung geht es nicht. Ich bitte um Nachsicht, falls diese nicht immer ganz themengerecht sein sollte.