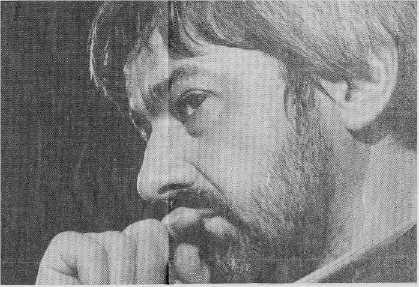Jurek Becker: Der Boxer (1976)
Ausgangssituation, Erzählperspektive und -technik:-
Ein namentlich nicht genannter Ich-Erzähler hat den Juden Aron Blank über zwei Jahre hinweg über dessen Leben interviewt und legt ihm nun das Ergebnis in Form von fünf Heften vor. Dieser will jedoch die Hefte nicht lesen.
Damit beginnt der Roman. Im folgenden schildert der Erzähler die Geschichte des Aron Blank, der Leser darf annehmen, dass dies nun der Inhalt der fünf Hefte ist. Gelegentlich wird die auktoriale Erzählweise unterbrochen durch die Einblendungen von und Rückblicke auf die Gespräche, die der Chronist mit Aron Blank geführt hat. Auf dieser zusätzlichen Ebene werden die Ereignisse und Handlungsweisen kommentiert, reflektiert und durch dialogische Elemente angereichert.
Zitiert wird nach der Suhrkamp Taschenbuch Ausgabe des Romans, Frankfurt 1981
1.
Der aus Riga stammende Jude Aron Blank kehrt nach sechs Jahren Inhaftierung in deutschen Konzentrationslagern in den ostdeutschen Nachkriegsalltag zurück und beschafft sich zuerst eine Identität in Form eines Ausweises. Seine einzigen Papiere sind die Entlassungspapiere aus dem KZ. Aron nimmt die Gelegenheit wahr und verändert seinen Vornamen in den unverfänglicheren Namen Arno. Als anerkanntes Opfer des Naziregimes wird er bevorzugt behandelt und bekommt die Wohnung eines inhaftierten Nazis zugewiesen.
In den ersten Tagen säubert er diese Wohnung von allem, was an einen Nationalsozialisten erinnert, z.B. auch Ölgemälde.
Der Leser erfährt, dass Arno seine Frau und zwei Kinder in einem polnischen Ghetto verloren hat und dass er seinen zweijährigen Sohn bei der Deportierung in der Obhut einer wenig vertrauenswürdigen Nachbarin zurückgelassen hat.
Als nächstes bemüht er eine amerikanische Suchorganisation diesen seinen Sohn ausfindig zu machen und tatsächlich wird ein Kind gefunden, welches den Namen Mark trägt (allerdings mit Nachnamen Berger statt Blank) und sein Sohn sein müsste. - Die junge Dame von "Joint", Paula, bald auch Arnos neue Geliebte, vermittelt Arno eine Mitfahrgelegenheit zum Pflegeheim in Bayern, wo Mark und die anderen überlebenden Kinder wieder aufgepäppelt werden.
2.
Das Kind ist sehr schwach und weiß nichts von Vater und Mutter. Einzig die Augenfarbe gibt Arno Anlass zu glauben, dass dies sein Sohn sei. Er veranlasst die Namensänderung und fährt am übernächsten Morgen im Militärfahrzeug zurück
Paula wohnt jetzt bei Arno, was zunächst für beide - trotz des Altersunterschiedes - sehr befriedigend und umkompliziert ist. Arno ist der Hausmann, bis Paul ihn eines Tages auffordert sich eine Arbeit zu suchen, denn zu tun gäbe es genug. - In einer Kneipe, wo sich die "Übriggebliebenen"(S.88) täglich treffen, wird er von einem ehemaligen Mithäftling an den Unternehmer Tennebaum weitervermittelt, der ihn nach einem kurzen Gespräch als Buchhalter einstellt. Arno muss dafür wenig arbeiten und wird gut bezahlt. Aber er trinkt zu viel, ist antriebslos, gleichgültig und letztendlich vereinsamt. Dies führt zum Streit mit Paula, vor allem als die Nachricht von der Atombombe auf Hiroshima kommt, Paula darüber empört ist, Arno das nur gerecht findet. Sie wirft ihm vor "voll Haß" zu sein (107).
Es gelingt Arno, im sowjetischen Sektor Berlins einen Platz in einem Kindererholungsheim für Mark zu erhalten. Für die Abholung und den Empfang Marks besorgt sich Arno auf dem Schwarzmarkt so unmögliche Dinge wie Schokolade, Spielzeug und ein Fahrrad.
3.
Mark wird ins Erholungsheim überführt und von nun an vom Vater täglich besucht - trotz der langen Anfahrt mit Zug und Fahrrad. Arno lässt sich auf dem Schwarzmarkt - hier hilft ihm sein ehemaliger Lagergefährte Kenik - teure und gute Lebensmittel für Mark besorgen.
Als erzieherisches Konzept beschließt er des weiteren, sich selbst als Vorbild zu erfinden, d.h. wie er hätte gewesen sein können als Junge, und erzählt Mark pädagogisch wertvolle Jugend-Geschichten.
Dann zieht Paulka überraschend aus (136), da "Joint" ihren Verlobten Walter wiedergefunden hat. Dies stürzt Arno in eine Krise und er trinkt noch mehr als zuvor. In der Kneipe lernt er den 60-jährigen Ostwald kennen, einen Richter, den die Nazis in Zuchthaus und KZ gesteckt haben. Wochenlang trinken sie gemeinsam, bis Arno Mark aus dem Heim abholen darf. Von nun an dreht sich für ihn alles um das Kind, Ostwald zieht sich aus der Beziehung zurück und begeht später Selbstmord.
Statt dessen tritt jemand anderes in Arnos Leben, nämlich Irma, die von mark so geliebte Krankenschwester. Arno besucht sie im Heim und bietet ihr bei ihm als Haushälterin einzuziehen.
4.
An Marks siebtem Geburtstag sagt Irma zu, zieht wenig später ein und teilt bald Tisch und Bett mit Arno. Dieser kündigt beim Schieber Tennenbaum und lässt sich bei der russischen Kommandantur als Dolmetscher instellen (193). Mit dem russischen Offizier, für den er übersetzt, muss er sich gelegentlich darüber verständigen, wie die Deutschen sind und wie sie zu behandeln seien. Arno wirft dem Offizier zu viel Höflichkeit und Geduld vor (207).
Mark wird eingeschult und lernt gut, eines Tages jedoch wird er von einem Mitschüler böse verprügelt. Arno ist empört und will sich einmischen, ändert jedoch seine Meinung und überlegt, wie er Mark "bewaffnen" kann (222). Dazu erinnert er sich an sein Konzept des erfundenen Vorbilds und er erzählt Mark die Geschichte vom Boxer: Wie er selbst als Junge verprügelt wurde, dann in einen Box-Verein eintrat, mächtig trainierte und schließlich den Tyrannen vor aller Augen verprügeln konnte. Mark ist beeindruckt und wird bald daraufhin Mitglied in einem Box-Verein.
Arno wird ernsthaft krank (angina pectoris) und muss zu einer dreimonatigen Kur. Dort erfährt er, dass sein Sohn ohne hinreichenden Grund Mitschüler verprügelt hat. Er ist alarmiert und redet Mark ins Gewissen: Es genügt nicht stark zu sein, sondern man muss ein "beliebter Starker" sein.
Nach der Kur lässt sich Arno berenten, Irma gibt erfolgreich Klavierstunden zu Hause, dies aber treibt Arno wieder in die Kneipe zu Alkohol und Nikotin, er erleidet eine Herzattacke, woraufhin Irma sofort ihren Klavierunterricht aufgibt.
5.
Der Interviewer wirft Arno Passivität und politische Indifferenz vor. Dieser widerspricht dem nicht.
Auf Wunsch von Irma und Mark lässt sich Arno zu einer Reise ans Meer überreden - die erste Reise überhaupt - da kommen die Unruhen vom 17. Juni 1953 dazwischen. Arno versteht die Streikenden nicht (er meint, so könnten auch "Pogrome" anfangen), begrüßt statt dessen die Ankunft der russischen Panzer und zieht sich mit seiner Familie in die Wohnung zurück. Dann flüchten sie in den Urlaub an die Ostsee, als sie vier Wochen später zurück kommen, ist alles vorbei.
1955 zieht Irma aus, nachdem Arno sich nicht dazu überreden ließ, sie endlich zu heiraten. Der Abschied ist kurz und unsentimental - er steckt ihr noch 3000 Mark in den Koffer.
Mark macht ein sehr gutes Abitur und beginnt Mathematik zu studieren. Er bleibt zu Hause wohnen, eines Tages aber kommt er nicht mehr zurück. Statt dessen kommt ein Brief aus Hamburg, wo er sich niederlassen will. Er ist also "republikflüchtig" geworden. In diesem Brief rechtfertigt sich Mark mit dem Hinweis auf die Beziehungslosigkeit und Gleichgültigkeit seines Vaters, mit dem er nie darüber sprechen konnte, was ihn bewegt. Mark schreibt danach noch 60 bis 70 Briefe aus verschiedenen Ländern, keinen davon hat Arno beantwortet. Die letzten Briefe Marks kommen aus Israel, wo er in einem Kibbuz arbeitet. Im Juni 1967 hören die Briefe auf, in diesem Monat herrscht in Palästina Krieg und Arno ist sich sicher, dass Mark in diesem Krieg gefallen ist.
Siehe auch die Rezension von Marcel Reich-Ranicki, FAZ 19.2.1977
Zentrale für Unterrichtsmedien (ZUM e.V.) - Klaus Dautel 1999/2006 (cc)

Ohne ein bisschen Werbung geht es nicht. Ich bitte um Nachsicht, falls diese nicht immer ganz themengerecht sein sollte.