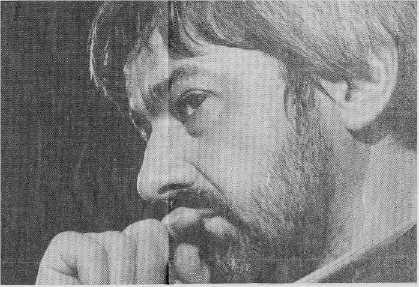Jurek Becker: Bronsteins Kinder (1986):
Untersuchungsaspekte
STRUKTURELEMENTE
SOMMER 1973 <-> SOMMER 1974
-----------------------------------------
Histor.: Tod Walter Ulbrichts Rücktritt Willy Brandts
Weltfestspiele
Situation im Abitur Warten auf das Studium
des Leben mit dem Vater Vollwaise
Erzählers: Liebe zu Martha beziehungslos
fester Wohnsitz auf Wohnungssuche
Kontakt zur Schwester Kontakt verloren (?)
||
\/
Krise -> Versuch der
Selbsttherapie durch
Erinnerung an Vaters Tod
(>Vergangenheitsbewältigung<)
Erzählzeit:
erinnerte Zeit erlebte Zeit
(Präteritum) (Präsens)
Handlungs- Verhör des Aufsehers Hans Versuch der
stränge: Liebesbeziehung Befreiung aus der
Schwester-Bruder-Beziehung Lethargie
THEMATISCHE ASPEKTE (für Arbeitsgruppen)
- Initiationsgeschichte
(vom Erwachsenwerden eines Jugendlichen)
- Liebesgeschichte (Kap. 19,25,30,35)
(vom Erkalten einer Liebe)
- Bruder-Schwester-Geschichte (Kap. 7,18,28)
(Gegenpole)
- Hans halbherzige Lösungsversuche (Aufzählung)
- jüdische Identität 30 Jahre nach dem Holocaust
(Hans Bronsteins ungewünschtes 'Judentum')
- Generationskonflikte (Kap. 9. 20, 32)
(Aktivismus der Alten - Indifferenz/Lethargie der Jungen)
- Rache, Recht, Gerechtigkeit und Gnade (Kap. 8,14,21,29)
(Die Deutschen - das minderwertige Volk)
- der Täter als Opfer, die Opfer als Täter (Kap. 10,31,32)
(Heppner, ein unschuldiger 'Mitläufer')
ZEITSTRUKTUR - HANDLUNGSEBENEN - ENTWICKLUNGSPROZESS
Entdeckung Tod des Krise Auszug
des Verhörs Vaters +---------------------+
+------------------------+ Trauerjahr | Sommer '74 |
| 11 Tage im Sommer '73 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~ +---------------------+
+------------------------+ || selbst-
|| || therapeut.
Hans Bronstein \/ \/ Versuch der
- ohne Identität Erfahrung soziale Vergangenheits-
(Jude?) von Isolation bewältigung ||
- an der Schwelle Hilf- Entfremdung || (Exodus)
zum Erwachsensein losig von Martha \/
- angepaßt und keit Heimatverlust -> Tod des Vaters
indifferent (85/6) seelisch verarbeitet
- hedonistisch (Martha) -> Selbsterkenntnis
-> Schritt in die
Selbständigkeit
'Bronsteins Kinder' könnte (mit Einschränkungen) als ENTWICKLUNGSROMAN bezeichnet werden.
"Der Entwicklungsroman gestaltet den inneren und äußeren Werdegang einer Hauptfigur von einem Ausgangspunkt bis zu einer gewissen Reife der Persönlichkeit. Dabei wird die Ausbildung vorhandener Anlagen des Helden in der dauernden Auseinandersetzung mit den Umwelteinflüssen dargestellt."
aus: Sachwörterbuch für den Literaturunterricht Klassen 9-12, Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin 1983 S. 159
Untersuchung von HANS BRONSTEINS SPRACHE (Seite 9/10 und 13/14)
Die Position des Erzählers zu seiner Umwelt ist:
- unemotional-distanziert, er beobachtet und kommentiert
Beispiel: die Fernsehgewohnheiten der Lepschitz, Hans sitzt zwar dabei,
nimmt aber nicht teil, sogar als sein Vater erwähnt wird, blickt er
nicht auf (9)
dem entspricht
- ein schnoddriger Tonfall zwischen Ironie und Sarkasmus
- und eine knappe, zuweilen reduzierte Sprache.
Im einzelnen:
Tonfall: umgangssprachlich, schnoddrig, mit Redewendungen
z.B. ich hätte meinen Kopf verwettet
es knistert in meinem Kopf
Gott behüte
'das ist schon wahr'(14)
man kann es glauben oder nicht (13)
Irgendwo zwischen Ironie und Sarkasmus:
'Angestelltenärmchen'
'sogar' das Abendbrot zubereiten
keine schönere Beschäftigung als
ich liebe sie nur nicht allzusehr
Übertreibungen und Untertreibungen (understatements)
Metaphern:
er lebt 'wie eine Stubenfliege' (10)
'eng wie im Neunerbus' (13)
'etwa die Hälfte meines Verstandes'(14)
mein Vater, 'selbst nicht der Lebendigste'(10)
der Rest von Zuneigung, 'dieser Bodensatz
Satzbau: viele kurze, meist einfache Sätze - wortkarg (lakonisch)
Wiederholungen werden nicht vermieden (Ich..Ich..)
Kaum Adjektive, es sei denn klischehaft eingesetzt
'riesiges Glück' 'nach erloschener Liebe'
'keine schönere Beschäftigung'
Zentrale für Unterrichtsmedien (ZUM e.V.) - Klaus Dautel 1999/2006 (cc)

Ohne ein bisschen Werbung geht es nicht. Ich bitte um Nachsicht, falls diese nicht immer ganz themengerecht sein sollte.