Hyperion und Diotima
Friedrich Hölderlin im Jahre 1797
Friedrich Hölderlin lebt und arbeitet seit Anfang des Jahres 1796 als "Privaterzieher" im Hause des Frankfurter Bankiers Gontard. Er unterrichtet den einzigen Sohn des Hauses, Henry, in fast allen Fächern, mit Ausnahme von Fechten, Tanzen und Französisch. Sein Gehalt ist ansehnlich, seine Stellung aber die eines Bediensteten im Range des Küchenpersonals ("Domestik"). Die Mutter seines Zöglings, Susette Gontard, ist seine Vorgesetzte, ein Jahr älter als er und - ganz im Gegensatz zu ihrem Gatten - an schöner Literatur, an Musik und neuerer Philosophie sehr interessiert.
 Susette Gontard |
"..dieses ganze Jahr haben wir fast beständig Besuche, Feste und Gott weiß! was alles gehabt, wo dann freilich meine Wenigkeit immer am schlimmsten wegkommt, weil der Hofmeister besonders in Frankfurt überall das fünfte Rad am Wagen ist, und doch der Schicklichkeit wegen muß dabei seyn." (An die Mutter Anfang 1798, StA 6,1 S.259) (Anmerkung 1)
Die eitle Umtriebigkeit des "Gesellschaftsmenschen" widerspricht Hölderlins kleinstädtisch- schwäbischer Herkunft ebenso, wie sie seiner empfindsamen Seele fremd ist. In einem Brief an die Schwester vergleicht er die beiden Welten:
"Dein Glük ist ächt; Du lebst in einer Sphäre, wo nicht viele Reichen, und nicht viele Edelleute überhaupt nicht viel Aristokraten sind: und nur in der Gesellschaft, wo die goldene Mittelmäßigkeit zu Hause ist, ist noch Glück und Friede und Herz und reiner Sinn zu finden (...). Hier z.B. siehst Du, wenig ächte Menschen ausgenommen, lauter ungeheure Karikaturen. Bei den meisten wirkt ihr Reichtum wie bei Bauern neuer Wein; denn gerad so läppisch, schwindlich, grob und übermüthig sind sie." (An die Schwester, April '98 StA 6,1 S.270)
Der kapitalistische Geist der Metropole und das Repräsentationsbedürfnis des Großbürgertums verdrießt ihn gehörig. Er spürt, in dieser Welt ist Bildung käuflich, eine Ware, und als solche hat sie zwar einen Preis, aber keine höhere Würde mehr. Damit ist auch der Vermittler dieser Ware käuflich und folglich austauschbar. In einem späteren Brief an die Mutter wird Hölderlin dies ganz deutlich formulieren:
"Aber der unhöfliche Stolz, die geflissentliche tägliche Herabwürdigung aller Wissenschaft und aller Bildung, die Äußerungen, daß die Hofmeister auch Bedienten wären, daß sie nichts besonders für sich fordern könnten, weil man sie für das bezahle, was sie thäten, (...) - das kränkte mich, so sehr ich suchte, mich darüber weg zu setzen, doch immer mehr und gab mir manchmal einen stillen Ärger, der für Leib und Seele niemals gut ist." (An die Mutter 10.10.1798, StA 6,1 S.283)
Ein Umstand aber, den er der Mutter gewiss nicht mitgeteilt hat, dürfte ganz entscheidend für den seelischen Verdruss des jungen Mannes gewesen sein: Er muss bei solchen Gesellschaften miterleben, wie seine sonst so wesens- und geistesverwandte Susette ihre Rolle als Hausherrin perfekt ausfüllt, wie sie repräsentiert, mit den Gästen scherzt, sie unterhält und ihren Hauslehrer darüber zu vergessen scheint.
In dieser Zeit schreibt H. ein Gedicht mit dem Titel "Die Eichbäume": Darin wandert ein lyrisches Ich heraus aus den von "fleißigen Menschen" gepflegten Gärten und hinauf in die Berge, wo die Eichbäume wie ein "Volk von Titanen" stehen, jeder für sich gewaltig und wie "ein Gott"; angesichts dieser erhabenen Unabhängigkeit der mächtigen Eichen wird sich das lyrische Ich seiner "Knechtschaft" in der Gesellschaft der Menschen bewusst. Das in Hexametern verfasste Gedicht endet mit den folgenden Zeilen:
"Könnt ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer
Diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben.
Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich,
Das von Liebe nicht läßt, wie gern würd ich unter euch wohnen!"
Die Beziehung zur Geliebten findet noch in anderen dichterischen Erzeugnissen dieser Jahre Gestalt. Allen voran in dem Briefroman mit dem Titel "Hyperion oder Der Eremit in Griechenland",
dessen erster Band im April zur Ostermesse erscheint. Über zwei Jahre später, im Herbst 1799 folgt der Zweite Band. Seiner Susette schreibt er ins Widmungsexemplar: "Wem sonst als Dir!"
Der Plan zu einem Roman, der einen freiheitsliebenden Griechen namens Hyperion zum Helden hat, ist schon aus der Zeit im Tübinger Stift 1792 belegt. Über die folgenden Jahre hinweg entwirft Hölderlin mehrere Fragmente, versucht eine Fassung in Versen und kehrt schließlich wieder zur Prosa-Form zurück. Friedrich Schiller fördert den Fortgang der Arbeit, indem er in seiner Zeitschrift "Thalia" Briefe aus dem Hyperion veröffentlicht und schließlich sogar einen Vertrag mit dem Tübinger Verleger Cotta vermittelt: 100 Gulden soll der junge Nachwuchsdichter erhalten, jedoch nicht, wie von Hölderlin erhofft, für einen Band, sondern für das ganze Werk. Gewiss nicht viel, gemessen an dem, was Schiller für sich selbst bei Cotta herauszuhandeln vermochte.
Zum Vergleich noch ein paar Zahlen: Für Hölderlin entsprach dieses Honorar einem Vierteljahresgehalt. Er erhielt jährlich 400 Gulden bei freier Kost und Logis, ein Offizier, der für Uniform und Pferd selbst aufkommen musste, 150 Gulden, ein Frankfurter Schullehrer lebte mehr schlecht als recht von 75 Gulden. Schiller erhält zur gleichen Zeit von Cotta pro Bogen (16 Seiten) etwa 16 Gulden. Hölderlin hatte sich in Jena ausgerechnet, dass er "von 4 Bogen (...) bequem ein halbes Jahr leben" könnte (VI, 157), wenn Schiller ihn als Mitarbeiter seiner Zeitschrift "Horen" heranzöge, was dieser aber leider nicht tat. Genau genommen erhielt Hölderlin nur 97 Gulden, denn die 11 Freiexemplare wurden abgezogen. Verkauft wurde der Band, also der halbe Hyperion, für 10 Groschen (ein Gulden hatte 24 Groschen). (Anmerkung 2)
Doch nun zum Roman: Schauplatz ist das Griechenland des ausgehenden 18. Jahrhunderts, jetzt unter türkischer Fremdherrschaft und nur noch ein kläglicher Schatten seiner einstigen Größe.
Die Handlung des Hyperion gestaltet sich recht ereignisreich: Der Leser erlebt eine vorbildliche Lehrer-Schüler-Beziehung (Hyperion - Adamas), eine echte und wechselvolle Männerfreundschaft (Hyperion - Alabanda), eine gefühlvolle Liebesbeziehung (Hyperion - Diotima), eine wilde Verschwörerbande (Bund der Nemesis), einen fehlgeschlagenen griechischen Befreiungskrieg, schändliche Plünderungen, eine türkisch-russische Seeschlacht, ein Vater-Sohn-Zerwürfnis, Selbstmordpläne, Abschiedsbriefe, Tod der Geliebten und tragisches Zuspätkommen, schließlich zielloses Herumirren in der Welt, unter anderem auch in Deutschland.
Hyperion selbst ist ein junger Grieche, welcher es sich in den Kopf gesetzt hat, sein Vaterland vom türkischen Joch zu befreien und sich davon auch nicht durch den Rat seiner wesentlich besonneneren Geliebten abbringen lässt. Zum Volksbefreier sei er nicht geeignet, hält Diotima ihm vor, wohl aber zum Volkserzieher. Vorher aber solle er in die Welt hinaus gehen, ins Ausland, um dort seinen Geist zu bilden und so zum "Erzieher unsers Volkes" gereift zurückzukehren.
Die Befreiungstat scheitert an der Disziplinlosigkeit seiner Männer. "Es war ein außerordentliches Projekt, durch eine Räuberbande mein Elysium zu pflanzen", so klagt Hyperion und beschließt, in der nächsten Seeschlacht gegen die Türken auf russischer Seite unterzugehen. Er wird gerettet, die Lebensgeister kehren zurück, er erinnert sich auch wieder seiner geliebten Diotima, entwirft noch Pläne einer gemeinsamen Zukunft außerhalb Griechenlands, er schlägt ihr vor in den "Alpen oder Pyrenäen" ein "Leben in goldener Mittelmäßigkeit" zu beginnen, aber zu spät. Diese ist schon an Schwermut gestorben, nicht ohne ihm zuletzt noch Erfüllung in "dichterischen Tagen" zu prophezeien. So irrt Hyperion rastlos und ohne Lebenssinn in der Welt herum, bis er schließlich "unter die Deutschen" kommt, wo er als Fremdling ankommt und als Fremder wieder geht. Seitdem lebt er als Eremit in den Bergen Griechenlands, sein Geschick in Briefen rekapitulierend, nur gelegentlich getröstet und begeistert von dem Erlebnis der alle Gegensätze vereinenden und aussöhnenden Kraft der Natur.
So ereignisreich die Fabel des "Hyperion" auch sein mag, im Zentrum stehen die Erinnerungen des Eremiten, seine rückblickenden Betrachtungen, geschichtsphilosophische Reflexionen über die Trefflichkeit des klassischen Athenervolkes und die Kläglichkeit der heutigen Welt, Gedanken über die richtige Erziehung des Menschen zum Menschen. Das Wichtigste wird dem Leser im Dialog der Hauptfiguren, in deren "Seelengesprächen" vor Augen gebracht, in Abschnitten von wunderschöner Intensität und Gedankentiefe, aber auch von absichtsvoll-idealistischer Realitätsferne.
Bei der Lektüre des "Hyperion" sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass hier ein junger Mann von Mitte Zwanzig schreibt, ein empfindsamer Schöngeist, ein begeisterter Idealist und unglücklicher Liebhaber.
Hyperion, der griechische Jüngling, ist ein unausgeglichener Schwarmgeist, der schon in jungen Jahren die Kluft zwischen seinen Idealen und der erfahrenen Wirklichkeit tief empfindet und erleidet. Und "... mitten in (s)einen finsteren Tagen" erscheint ihm "das Göttliche", das Eine und Alles, dessen Name Schönheit ist und - Diotima heißt. In ihrer Gegenwart erlebt er höchstes Glück, den Himmel auf Erden, er, dessen Gemüt doch voller Widersprüche, "voll blutender Erinnerungen" und voll "wilder Trauer" ist.
In einem ihrer "Seelengespräche" über Freundschaft und Liebe erkennt Diotima rasch, woran Hyperion leidet: Es ist dieses grenzenlose Verlangen nach "einer besseren Zeit", die rückhaltlose Hingabe an das Idealische, Vollkommene, folglich auch das tiefe Leiden an dem "Verlust von allen goldenen Jahrhunderten". Dieses Verständnis von Hyperions Leiden und Idealismus macht ihm Diotima zur Seelenverwandten und Seelentrösterin: Diotima, die Pflegerin der kranken Seele, die Heilerin des unausgeglichenen Gemütes, die Besänftigerin der wilden Leidenschaften. Diotima ist die Verkörperung von innerer Ausgeglichenheit, seelischer Harmonie, kurz: ein Wesen der "goldenen Mitte". Und weil das, was für die menschliche Seele wahr und gut ist, nach klassischem Verständnis auch schön sein muss, macht Hyperion seine Diotima zum Zentrum eines Kultes der Schönheit und der Liebe. Dem Liebhaber wird alles heilig, was an das Geliebte mahnt, die Orte der ersten Begegnung ebenso wie die Worte, die gewechselt werden.
Wie sein Ziehvater Schiller, wie sein Studiengefährte Hegel, so sah Hölderlin das Grundübel der neuen Zeit in der Reduzierung des Menschen auf eine bestimmte Tätigkeit, einen nützlichen Zweck, ein Funktionsteil im seelenlosen Räderwerk der Staatsmaschinerie. Heute würden wir das mit einem Wort bezeichnen: Arbeitsteilung. Deren Effizienz ist unbestritten, deren Seelenlosigkeit bewirkt aber tiefes Leid, welches den Menschen selbst nur selten bewusst ist. Einzig der Dichter, ausgestattet mit jenem empfindsamen Gemüt, das Hölderlin den Genius nennt, weiß um den Verlust jener Ganzheitlichkeit, die einst den Menschen des klassischen Griechenlands ausgezeichnet haben soll. Die Dichter jedoch, namentlich jene in Deutschland, werden behandelt "wie Fremdlinge im eigenen Hause".
So steht es im letzten Brief Hyperions, wo er sich in gewaltigen Worten über die Deutschen beklagt: Sie leben in einem System voller Unterscheidungen und Trennungen, in einer mechanischen Welt der Arbeitsteilung und Funktionalität, nicht aber im Geiste der Harmonie, des Ausgleichs und der Versöhnung der Gegensätze. In den Worten Hyperions klingt das so:
"... ich kann kein Volk mir denken, das zerißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungenudn gesetzte Leute, aber keine Menschen - ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und Gleider zerstückelt untereinander liegen ... ? Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sage es auch. Nur muß er es mit ganzer Seele treiben, muß nicht jede Kraft in sich ersticken, wenn sie nicht gerade sich zu seinem Titel paßt ... und ist er in ein Fach gedrückt, wo gar der Geist nicht leben darf, so stoß ers mit Verachtung weg und lerne pflügen!"
Dieser Aufsatz wurde verfasst für und veröffentlicht
im Jahrbuch 1997 des Hölderlin-Gymnasiums Nürtingen.
Klaus Dautel, 2000-2009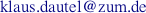
- [an error occurred while processing this directive] -
Ohne ein bisschen Werbung geht es nicht. Ich bitte um Nachsicht, falls diese nicht immer ganz Themen-gerecht sein sollte.


