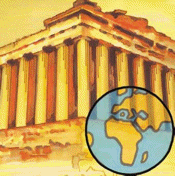Stimmen des Westens
|
Werner Welzig, Der Deutsche Roman im 20. Jahrhundert (1970)
Im Zentrum von Wolfs ... Erzählung stehen die angehende Lehrerin Rita Seidel und der am Ende seiner Hochschulausbildung angelangte Chemiker Manfred Herrfurth. Die aus dem Rükktlick in chronologischer Abfolge bis zu dem Zielpunkt des Jahres 1961 berichtete Geschichte der Liebe, die zwischen diesen beiden wächst, mündet in die Geschichte Deutschlands. Manfred Herrfurth geht nach Westberlin, da er dort bessere Arbeitsbedingungen findet. Rita Seidel folgt ihm zwar, doch nur für einen kurzen Besuch. Sie verzichtet auf den Mann, den sie liebt, und kehrt in den Staat zurück, in dem sie aufgewachsen ist und dem sie sich zugehörig fühlt. "Der geteilte Himmel" ist die Geschichte einer Liebe, die sich nicht erfüllt, die sich nach Auffassung der Autorin nicht erfüllen kann, da die Geschicke des Staates die Liebenden vor Fragen stellen, die sie auf Grund ihres Charakters und ihres Werdeganges unterschiiedlich beantworten müssen. Christa Wolf bindet ihre Figuren mit voller Deutlichkelt an die gesellschaftlichte Umgebung, der sie entstammen. Schon der Romaneingang Symbol der fordernden Macht der Umwelt: Geballter Rauch aus hundert Fabrikschornsteinen legt sich schwer auf die Menschen, und das nach Chemie stinkende Wasser schmeckt ihnen bitter.
Geschichte der deutschen Literatur - Vom 18. Jh bis zur Gegenwart, hrsg. von Viktor Zmegac (1984): Christa Wolf
...Aber auch Autoren, die sich dem Bitterfelder Ansatz mit weniger gemischten Gefühlen anschlossen, hatten ihre Schwierigkeiten, die neuen Erlebnisse in der Arbeitswelt mit ihren Literaturvorstellungen in Einklang zu bringen. Vier exemplarische Romane dieser Jahre, Christa Wolfs Der geteilte Himmel (1963), Erik Neutschs Spur der Steine (1964), Strittmatters Ole Bienkopp (1963) und Karl-Heinz Jakobs Beschreibung eines Sommers (1961) ... wurden ... Gegenstand einer breiten, zum Teil heftigen Diskussion in der DDR-Öffentlichkeit und gehören noch heute zu den meist gelesenen und diskutierten Werken der DDR-Literatur. Walter Killy: Literaturlexikon - Autoren und Werke deutscher Sprache (1993) Wolf, Christa, geb. Ihlenfeld, * 18. 3. 1929 Landsberg/Warthe (heute: Gorzów Wielkopolski/Polen).
... Nach ersten, heute vergessenen Anfängen mit der Moskauer Novelle (Halle 1961) entwickelte W. ihre Leitmotive. Seit dem Roman "Der geteilte Himmel" (ebd. 1963, Bln. 1964. Film 1964; Regie: Konrad Wolf) stellt sie die Utopie der personalen Ganzheit den Sinnverlusten in der Realität gegenüber, begreift sie den Kampf alter Verhältnisse mit den Zielen u. Wünschen einer in die Zukunft blickenden Gesellschaft als existentiellen Konflikt, sinnt sie der Verbindlichkeit moralischer Maßstäbe im individuellen Dasein nach. W.s Werk kann man als eine vielfach variierte Selbsterforschung ansehen, wobei zunehmend zivilisationskrit. Züge u. emanzipator. Gesichtspunkte zum Vorschein kommen. Ihre Frage nach dem Individualitätsrecht des einzelnen ist gegen einen absolut gesetzten Kollektivismus gerichtet, doch ist sie auch als Suche nach der Abweichung in der Gesellschaft verallgemeinerbar. W. ist mit ihrem in beiden dt. Staaten viel beachteten Werk zur repräsentativen Schriftstellerin des geteilten Deutschland geworden. Mit einer Liebesgeschichte erzählt W. im Roman "Der geteilte Himmel" von aktuellen Problemen am Vorabend des Mauerbaus. Der Himmel, »dieses ganze Gewölbe von Hoffnung und Sehnsucht, von Liebe und Trauer«, teilt sich schließlich endgültig. Der Chemiker Manfred Herrfurth u. seine Verlobte Rita Seidel, eine Pädagogikstudentin, trennen sich: Vergeblich versucht Rita, Manfred zur Rückkehr zu bewegen; er ist aufgrund von Schwierigkeiten mit den Planungsbehörden nach West-Berlin gegangen. Ritas Rückweg bewirkt einen krisenhaften seel. Prozeß, der ihr jedoch die Eingliederung in die DDR wieder ermöglicht. Die kunstvolle Technik der übergangslosen Rückblenden u. der Schichtung von Zeitebenen hebt dieses Buch weit über die Erzeugnisse der »Ankunftsliteratur« hinaus, löste jedoch auch heftige Kontroversen aus. |
←
Ohne ein bisschen Werbung geht es nicht. Ich bitte um Nachsicht, falls diese nicht ganz themengerecht sein sollte.