|
Mit der Ausstellung „Benedikt und die Welt der frühen
Klöster“ widmen sich die Reiss-Engelhorn-Museen
der Geschichte der Benediktinerklöster in Europa.
Rund um die Figur des heiligen Benedikt erfahren die Besucher
Spannendes über die Ursprünge der Klosterkultur
und deren nachhaltige Bedeutung für Bildung und Wissen
im Mittelalter. Neun thematisch gegliederte Abschnitte
führen von den ersten Klostergründungen über
die mittelalterliche Liturgie bis in die Gegenwart. Zahlreiche
kostbare Exponate illustrieren, wie Klöster entstanden
und wie das Leben der Mönche zwischen Schreibstube
und Klostergarten aussah. Die Mitmach-Stationen des Skriptoriums
vermitteln einen Eindruck von der mittelalterlichen Buchmalerei
und der Kunstfertigkeit der Mönche. Abschließend
wirft die Ausstellung einen Blick auf das Leben der Benediktiner
in der Gegenwart.
 Benedikt von Nursia – Patron Europas Benedikt von Nursia – Patron Europas
Flankiert von zwei Heiligen begrüßt eine vergoldete
Benedikt-Figur den Besucher. In den Händen hält
sie die Regula Benedicti, die Ordensregel der Benediktiner.
Benedikt von Nursia gilt als der Vater des abendländischen
Mönchtums. Er wurde im Jahr 480 als Sohn reicher Eltern
geboren und zog sich bereits in seiner Jugend in die Einsamkeit
zurück. Aufgrund seiner vorbildlichen Lebensführung
wurde er zum Abt von Vicovaro gewählt und stand bald
zwölf Klöstern vor. 529 ging er nach Montecassino
und gründete dort das Mutterkloster des Benediktinerordens,
in dem er auch die Benediktsregel verfasste, bevor er um
das Jahr 555/560 starb. Die Klöster, die in der Nachfolge
des heiligen Benedikt entstanden, waren Jahrhunderte lang
Zentren geistigen Lebens. Über ganz Europa hinweg
bildeten sie ein Netz des Austauschs und der kulturellen
Kontakte. Besonders durch ihre zahlreichen Abschriften
antiker Texte und zeitgenössischer Lehrwerke trugen
die Benediktinermönche einen entscheidenden Teil zur
Wissensverbreitung im europäischen Mittelalter bei.
Einzelne Blätter kostbarer Handschriften, Bucheinbände
und eine Monstranz mit Benediktsreliquie zeugen zu Beginn
der Ausstellung von der Jahrhunderte andauernden Wirkung
Benedikts von Nursia, der 1964 von Papst Paul VI. zum Patron
Europas erklärt wurde.
Bild: Der heilige Benedikt übergibt die Regel.
Augsburg, 1. Viertel 17. Jahrhundert.
Pergament, Deckenfarbenmalerei, Tinte
Das Einzelblatt ist Teil einer verlorenen Handschrift.
Darstellung der Regelübergabe durch
den heiligen Benedikt, der unter einem roten Baldachinvorhang
thront. Links ist aufgrund des Wappens
Abt Johannes VIII. Merk (1600 – 1632) von
St. Ulrich und Afra in Augsburg dargestellt.
Hinter Benedikt die Statuen der heiligen Ulrich und Afra.
© Gerfried Sitar, Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal
Von Montecassino nach Europa – Die Regula Benedicti
 Benedikts Klostergründung in Montecassino wurde zur
Keimzelle des klösterlichen Lebens, besonders im Südwesten
des heutigen Deutschland. Der zweite Raum der Ausstellung
steht ganz im Zeichen der Verbreitung des Mönchtums
in Europa. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das mit
Edel- und Halbedelsteinen besetzte Adelheid-Kreuz. Das
Prunkstück aus der Schatzkammer des Stifts St. Paul
entspricht in seiner Größe und Form sowie seinem
Anspruch nach dem Reichskreuz in Wien. Das Reliquienkreuz
stammt aus dem 11. Jahrhundert und soll Splitter aus dem
Kreuz Jesu enthalten. Neben dem Adelheid-Kreuz sind in
diesem Raum weitere Exponate zu sehen, die die Bedeutung
der Benediktiner für die Geschichte des Mittelalters
illustrieren. Neben den Lorscher Annalen von 835 erzählen
Gemälde und Handschriften von der Taufe Chlodwigs
oder der Ermordung des heiligen Bonifatius. Benedikts Klostergründung in Montecassino wurde zur
Keimzelle des klösterlichen Lebens, besonders im Südwesten
des heutigen Deutschland. Der zweite Raum der Ausstellung
steht ganz im Zeichen der Verbreitung des Mönchtums
in Europa. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das mit
Edel- und Halbedelsteinen besetzte Adelheid-Kreuz. Das
Prunkstück aus der Schatzkammer des Stifts St. Paul
entspricht in seiner Größe und Form sowie seinem
Anspruch nach dem Reichskreuz in Wien. Das Reliquienkreuz
stammt aus dem 11. Jahrhundert und soll Splitter aus dem
Kreuz Jesu enthalten. Neben dem Adelheid-Kreuz sind in
diesem Raum weitere Exponate zu sehen, die die Bedeutung
der Benediktiner für die Geschichte des Mittelalters
illustrieren. Neben den Lorscher Annalen von 835 erzählen
Gemälde und Handschriften von der Taufe Chlodwigs
oder der Ermordung des heiligen Bonifatius.
Die Päpste erkannten ebenso wie die weltlichen Herrscher
den großen Vorteil, den ein Netz von über Europa
verteilten Benediktiner-Klöstern mit sich brachte.
Karl der Große (768-814) wurde zum aktiven Förderer
der Benediktiner und ließ 787 eine Kopie der Regel
des heiligen Benedikt von Montecassino nach Aachen bringen.
In der Ausstellung zu sehen ist eine ganz besondere Kostbarkeit:
Eine Darstellung der Übergabe der Regula Benedicti
aus dem 11. Jahrhundert, eine Leihgabe aus dem Mutterkloster
Montecassino. Benedikts Regelwerk besteht aus insgesamt
73 Kapiteln, die das Zusammenleben im Kloster ordnen. Sie
versprechen eine praktische Anleitung für ein Leben,
das sich der Suche nach Gott verschrieben hat. Das Original
der Regel ist nicht mehr erhalten, in der Ausstellung gezeigt
werden alte Abschriften aus dem 12. Jahrhundert aus dem
Elsaß sowie eine Regel aus dem Benediktinerstift
St. Paul aus dem Jahr 1499.
Bild: Monstranz mit Benediktsreliquie.
Nürnberg, 1. Hälfte 15. Jahrhundert,
Messing, vergoldet, gegossen, graviert.
Turmmonstranz zur Reliquienaufbewahrung. Sie gehört
zu einer größeren Gruppe von
Arbeiten, die in großen Stückzahlen in Nürnberg
gefertigt wurden. © Gerfried
Sitar, Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal
Der St. Galler Klosterplan und die Gründung eines
Klosters
Von den Klostergründungen des Mittelalters zeugen
heute neben den Gemäuern manchmal nur Urkunden, originale
Baupläne sind eine äußerste Rarität.
Ein Plan ist durch ein Leuchtbild im dritten Teil der Ausstellung
zu studieren. Der Besucher kann hier den St. Galler Klosterplan
aus dem Jahr 820/835 betrachten. Dieser aus fünf Pergamentstücken
genähte Grundriss stellt anschaulich den Aufbau eines
Klosters dar. Es ist ein Idealplan, der die Lage von Kirchen,
Wirtschaftsgebäuden und Gärten in einem karolingischen
Großkloster zeigt. Er belegt, dass Klöster nicht
nur religiöse Zentren, sondern auch wirtschaftliche
Großbetriebe mit einer autarken und differenziert
strukturierten Gemeinschaft waren. Im Eingangsbereich der
Ausstellung ist ein Modell zu sehen, welches in einer Schulkooperation
nach dem Idealplan gebaut wurde.
Passend zum St. Galler Klosterplan wird im anschließenden
Ausstellungteil der Ablauf einer Klostergründung beispielhaft
dargestellt. Der Besucher erfährt, wie Klöster
entstanden, aber auch welche Rolle diese Gründungen
spielten. Ziel der Klostergründungen war es, Gebiete
zu christianisieren und urbar zu machen. Stifter stellten
oft die finanzielle Ausstattung der Klöster oder unterstützten
Mönche gezielt bei der Neugründung. Teilweise
spielten auch Reformen oder Vertreibungen von Mönchen
eine Rolle bei der Entstehung neuer Klöster. Beispielhaft
vorgestellt werden z.B. Lorch, Hirsau oder St. Paul in
Kärnten. Zu sehen sind neben Papst Urbans Bestätigung
für Kloster Hirsau auch Handschriften aus dem Stift
St. Paul und das Privileg, welches Kaiser Barbarossa für
das Kloster Lorch ausstellte.
 Goldenes Handwerk Goldenes Handwerk
In den neugegründeten Benediktinerklöstern entstanden
zahlreiche kunsthandwerkliche Schätze. Im diesem Teil
der Schau kann sich der Besucher von deren Pracht und überragender
Qualität selbst ein Bild machen. Die Benediktiner
förderten das Handwerk und prägten die christliche
Ikonographie nachhaltig. Neben Motiven des heiligen Benedikt
spielten auch Mariendarstellungen eine wichtige Rolle.
Bei den Benediktinern diente die prunkvolle Ausstattung
der Klosterkirche mit luxuriösen Materialien und aufwendigen
Techniken der Verherrlichung Gottes. Davon zeugen neben
den kostbaren liturgischen Gegenständen in diesem
Raum auch die kostbaren Handschriften. Zu sehen sind neben
einer vergoldeten Hostienmonstranz und Prunkkelchen ein
Abtstab aus St. Blasien sowie der Einband des Reichenauer
Sakramentars, dessen filigrane Elfenbeintafel die Himmelfahrt
Christi abbildet. Ein besonderer Höhepunkt ist der
vergoldete und detailreich gestaltete Deckel eines Buchkastens.
Er wurde um 1260 in Straßburg gefertigt und gehört
zu den bedeutendsten Werken der europäischen Goldschmiedekunst
in der Gotik.
Bild: Benediktskelch.
Johann Jakob I. Frings, Augsburg, um 1700.
Silber, vergoldet, gegossen, Edelsteine, Email.
Die Medaillons des Kelchs zeigen Szenen aus dem Leben des
heiligen Benedikt. Das prunkvolle
Stück entstand um 1700 in Augsburg und
war Teil des Kirchenschatzes der Benediktinerabtei
St. Blasien im Schwarzwald, bevor es nach St. Paul im Lavanttal
kam. ©
Gerfried Sitar, Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal
Skriptorium
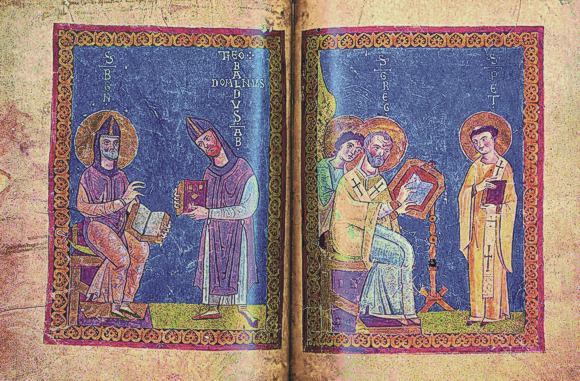
Handschrift „Moralia in Iob“.
Abt Theodor von Montecassino erhält die Regel aus
den Händen des heiligen Benedikt
(links) und Autorenbild Gregors des Großen (rechts).
Montecassino, 1022 – 1035. ©
Montecassino, Archivio dell’Abbazia, Cod. Cassin.
73
Ein Exkurs in die Schreibkunst des Mittelalters erwartet
den Besucher in einem rekonstruierten Skriptorium. Nach
der Regel des heiligen Benedikt ist neben dem Gebet und
der körperlichen Arbeit auch die geistige Auseinandersetzung
ein zentraler Teil des klösterlichen Lebens. Das Kopieren
und Abschreiben wichtiger Texte im Skriptorium – von
der Heiligen Schrift bis zu den Werken antiker Philosophen – war
Alltagsarbeit in einem mittelalterlichen Benediktinerkloster.
Die Arbeit der Mönche und Nonnen an einem Werk nahm
oft mehrere Monate in Anspruch. Der Besucher erhält
im Skriptorium einen Einblick in eine mittelalterliche
Schreibstube und erfährt anhand von Texten und Mitmach-Stationen,
wie dank der klösterlichen Schreibkultur Wissen weitergegeben
wurde und was die Handschriften der Mönche so wertvoll
macht. Auch die Kunst der Buchmalerei wird thematisiert.
Liturgie im Mittelalter
Der nächste Ausstellungsteil widmet sich ganz der
Liturgie des Mittelalters. Liturgie bezeichnet die Gesamtheit
der Handlungen im christlichen Gottesdienst. Im Mittelalter
wurde ihr eine besondere Bedeutung beigemessen, da man
glaubte an ihr hinge das Heil des Einzelnen – vom
Mönch bis zum Herrscher. Nur ihre formgerechte und
regelmäßige Ausführung gewährleistete
Gottes Kraft und Gnade für jedermann. Die Liturgie
prägte daher den gesamten Jahresablauf und begleitete
die Menschen von der Geburt bis zum Tod. Bei den Benediktiner-Mönchen
war sie durch das Stundengebet allgegenwärtig. Für
eine würdevolle Ausführung der Liturgie nutzten
die Mönche zahlreiche Gegenstände. Zu sehen ist
eine Auswahl zentraler Objekte für die Messe oder
das private Gebet. Gezeigt werden neben reich bestickten
Textilien – darunter einzigartig gut erhaltene Messgewänder
aus dem 12. und 13. Jahrhundert – auch Meßkelche,
Kruzifixe und Weihrauchbehälter. Den Besucher erwarten
außerdem wertvolle und seltene Handschriften mit
kunstvollen Miniaturen, wie der Ramsey-Psalter für
den privaten Gebrauch des Abts John of Sawtry (1286 – 1316),
das Reichenauer Sakramentar, das Bernauer Missale und das
Spanheimer Evangeliar.
Bildung, Wissen und Musik
Der achte Teil der Ausstellung widmet sich dem kulturellen
Beitrag der Benediktiner im werdenden Abendland. Da die
geistige Arbeit ein Teil des Ordenslebens war, wurden die
Schreibstuben der Klöster zu Keimzellen der Bildung.
Antike Texte und wissenschaftliche Abhandlungen verbreiteten
sich von ihnen ausgehend über ganz Europa. Zu verdanken
war dies einer historisch einmaligen Situation: Nach dem
Untergang des weströmischen Reiches und dem dadurch
bedingten Zusammenbruch der Infrastruktur übernahmen
die Klöster als Träger der Schriftkultur die
Bewahrung und Überlieferung von antikem Wissen. Die
reichen Buchbestände der noch heute erhaltenen mittelalterlichen
Klosterbibliotheken zeugen von der nachhaltigen Wirkung
dieses Wissenstransfers von der Antike in das christliche
Europa. Von diesem profitierten auch die Naturwissenschaften.
Stellvertretend gezeigt werden wertvolle Abschriften theologischer,
mathematischer, historischer oder medizinischer Werke.
Darunter befindet sich unter anderem ein medizinischer
Sammelband aus dem 11. Jahrhundert. Die Vielfalt der Bücher
reicht von staatstheoretischen Abhandlungen bis hin zu
philosophischen Traktaten in Latein. Selbst verbotene Werke,
die sich beispielsweise mit der Astronomie auseinandersetzten,
fanden ihren Weg in die Schreibstuben und blieben so der
Nachwelt erhalten. Besonderen Wert legten die Benediktiner
auf die Musik, sie galt als geistiges Wissen und war fester
Bestandteil des kontemplativen Lebens. Die Ausstellung
zeigt frühe musiktheoretische Abhandlungen der Benediktiner
und thematisiert ihre Rolle bei der Entstehung des gregorianischen
Chorals.

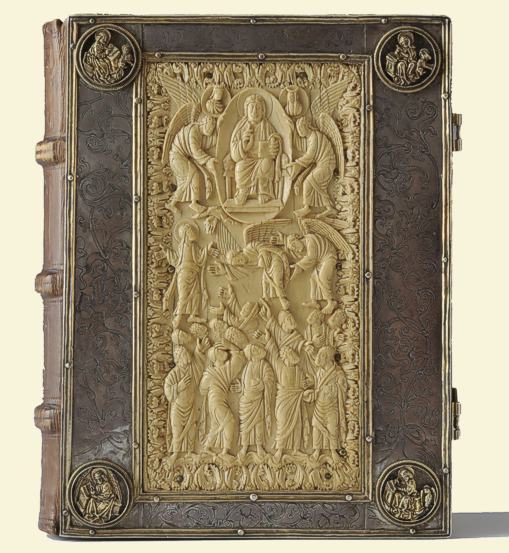
Reichenauer Sakramentar (Ausschnitt und Bucheinband)
Reichenau, um 980.
Pergament, Deckenfarbenmalerei
Einmalig sind in diesem Sakramentar die Darstellungen zum
Messopfer. Der qualitätvolle
Buchschmuck wird der Reichenauer Ruodprechtgruppe zugeordnet.
Buchdeckel Oberrhein, Ende 15. Jahrhundert (Rahmen), Metz,
9. Jahrhundert (Elfenbein).
Holzkern mit Silberbeschlag, teilvergoldet, Silberguss, Elfenbein
Prachtdeckel des im späten 10. Jahrhundert auf der Reichenau geschriebenenSakramentars.
Die Elfenbeintafel zeigt die Himmelfahrt Christi, die Rahmenleiste
schmückenvier Medaillons mit den Evangelisten. © beide Bilder Gerfried
Sitar, Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal
Die Benediktiner heute
Nachdem die Ausstellung sich der Entstehung und Bedeutung
der Klöster im Mittelalter gewidmet hat, spannt sie
im letzten Abschnitt den Bogen in die Gegenwart. Am Beispiel
von Stift Neuburg bei Heidelberg und von Maria Laach in
der Eifel wird das Leben in heutigen Klöstern vorgestellt.
Existierten um das Jahr 800 allein in Frankreich an die
700 Benediktinerklöster, so sind es aktuell in ganz
Europa nur noch 550. Die Ordensmitglieder – von denen
es weltweit etwa 16.000 Nonnen und 8.000 Mönche gibt – sind
in den Klöstern weiterhin in der Buchbindekunst
und der Wissensvermittlung aktiv.
|