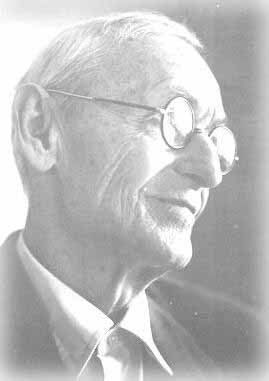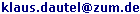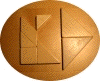SIDDHARTA. Eine indische Dichtung (1922)
 Schutzumschlag zur ersten amerikanischen Ausgabe 1951, Quelle: H.Hesse, sein Leben in Bildern und Texten, Suhrkamp 2000 S.339 |
Der Sohn des Brahmanen: Jugend in Geborgenheit, große Gelehrsamkeit und Hochachtung aller - aber: innere Unruhe, Unzufriedenheit, Wissensdrang beherrscht ihn: Wo ist das Innerste, das Letzte? (9/10) - Siddharta verlässt die Eltern um den Samanas zu folgen, sein Freund Govinda geht mit.
Bei den Samanas: Durch Askese lernt er die Abtötung von Trieb und Verlangen, jedoch umsonst (19). - Die Kunde von Buddha erreicht ihn (20) - Er und Govinda verlassen die Samanas.
Gotama: Auch der Buddha vertreibt nicht die Zweifel und die Unruhe: Jeder muss seine eigene Erlösung (WEG) finden, eine Lehre allein vermag dies nicht herbeizuführen, und eine Mönchsgemeinschaft ist nur Ersatz-Ich(30-32)
Erwachen: Selbsterfahrung tut not!
II.
Kamala
Bei den Kindermenschen
Sansara: Siddharta taucht ein in das 'Leben der Welt und der Lüste' (63), wird erfolgreicher Geschäftsmann und Liebhaber. Aber Abhängigkeiten entstehen, er verliert seine Distanz zur Welt - Trägheit und Habgier erfassen auch ihn - ein erneutes Erwachen ist nötig: Abschied vom Kinderspiel, 'Sansara' (70) und Flucht.
Am Fluss: Er hegt Selbstmordgedanken - Rettung durch das OM - Wiederbegegnung mit Govinda (75). Siddharta überdenkt sein bisheriges Leben und erkennt darin eine Folge von Wiedergeburten, von Sterben und Neubeginn, von Verwandlungen.
Der Fährmann: Siddharta sucht den Fährmann, dieser nimmt ihn auf und lehrt ihn das "Geheimnis des Flusses: Das es keine Zeit gibt"(87). Der Fluss als Gleichnis ewigen Seins: Er spricht OM. Kamala kommt als Pilgerin (90) mit ihrem Sohn - nach einem Schlangenbiss stirbt sie in S.s Armen.
Der Sohn: Das Vatersein als Prüfung - S. wird als Vater nicht anerkannt, der Sohn ist widerspenstig, verschwindet schließlich und hinterlässt die >Wunde<.
OM: Von dieser Wunde heilt ihn das OM, es füllt die Leere in ihm aus.
Govinda: Die Kunde von dem weisen Fährman am Fluss führt Govinda, den Suchenden, zu Siddharta. Er erfährt Siddhartas Weisheit: Es gibt keine Entwicklung (114/5), alles ist immer schon da, alles ist jederzeit alles, deshalb der Achtung wert.
Govinda ist von dieser Lehre irritiert, von Siddhartas Gestalt aber fasziniert. Schließlich wird ihm durch ihn jene Erfahrung zuteil, die Worte und Lehren nicht mitteilen können: Die Gleichzeitigkeit allen Daseins im Strom der Gestaltungen (120) und die Liebe zum Dasein in seiner immer fließenden Einheit!
Hermann Hesse: SIDDHARTA (Hefteintrag, Ethik Klasse 10/11)
Der Roman S. von H. aus dem Jahre 1922 beschreibt/schildert den Weg eines Brahmanensohnes durch alle Höhen und Tiefen des Daseins. Dieser Weg durchläuft eine Folge von (symbolischen) Wiedergeburten, Verwandlungen und Prüfungen, er führt Siddharta über Hinduismus und Buddhismus hinaus zur Erlösung/Vollendung.
Die Stationen dieses Lebensweges sind:
- Kindheit - Brahmanenschule - Askese und völlige Weltverachtung - Ablehnung der buddhistischen Mönchsgemeinschaft - "Leben der Welt und der Lüste": Geschäftsmann und Liebhaber - Selbstmordgedanke und Flucht - der Weise am Fluss - der liebende und leidende Vater - der Erleuchtete und Wissende um das Geheimnis des Daseins: OM - Erlösung von Unruhe, Sucht und BegierdeSIDDHARTAS WISSEN: Es gibt keine endgültige Wahrheit, jede Wahrheit ist Vereinseitigung. Es gibt keine Entwicklung, keine Zeit: Alles ist Gleichzeitigkeit. Es gibt nur den ewigen Strom, das Ineinander und Durcheinander der vielfältigen Gestaltungen. Welche Haltung ist dem Dasein gegenüber angemessen? Nicht allein Mitleid und Duldung (Buddha), sondern Liebe zu allem Existierenden (Siddharta), denn alles ist in allem enthalten! Siddhartas Weisheit steht im Widerspruch zu westlichen Denken: Dieses ist orientiert an wissenschaftlich-technischem Fortschritt, am Entwicklungsdenken, objektiven Wahrheiten, Gerechtigkeit statt Liebe!
Hugo Ball über Hermann Hesse und den "Siddhartha"
Ich zeigte, wie in der Seminaristenzeit das Zerwürfnis mit dem Vater sich entwickelte. Bald, mit den ersten Erfolgen des Dichters, und wohl schon mit dem Tode der Mutter, tritt im Verhältnis zum Vater eine Wandlung ein. Sie führt zwar noch nicht zu einem gegenseitigen Verständnis auch in religiösen Fragen, aber doch wohl zu einem wieder innigeren Austausch. Rührend ist es zu sehen, wie der Vater in einem Trostbüchlein für Leidende 1909, da er schon nicht mehr in Calw, sondern in Kornthal wohnt, eine Stelle aus seines berühmten Sohnes »Peter Camenzind« zitiert. Es ist bezeichnenderweise ein Passus, der die franziskanische Neigung des Camenzind zu seinem Krüppel-Freunde betrifft und wo es heißt: »Es begann eine gute, erfreuliche Zeit für mich, an der ich zeitlebens reichlich zu zehren haben werde.« Den Hesse-Philologen möchte ich jenes Büchlein (»Guter Rat für Leidende aus dem altisraelitischen Psalter«, Basel 1909) und überhaupt von da an die Schriften des Vaters sehr ans Herz legen. Sie enthalten ein gut Stück Entstehungsgeschichte und Hintergrund zum »Siddhartha«. Denn der Präzeptor Lohse in »Gertrud«, der die Karma-, die Schicksalslehre vorträgt, ist kein anderer als des Dichters Vater selbst. Er ist, von Blutsbanden ganz unabhängig, der erste Freund und auch der erste Mystagoge seines Sohnes gewesen. (...)
Lange vorher schon, 1911, zur Zeit der Indienreise, ist die Gestalt des Vaters im »Singapur-Traume« mild geworden. »Ich lehre dich nicht, ich erinnere dich nur«, spricht die vertraute Stimme. 1913 erscheint ein Buch des Vaters, »Aus Henry Martyns Leben, Briefen und Tagebüchern«, und es ist die Geschichte eines indischen und persischen Missionars. Johannes Hesse verfügt darin über eine große Skala der Darstellungsmittel. Politisch-religiöse, kulturelle und ethnographische Interessen zeigen das Bild jenes evangelischen Märtyrers in vielseitiger Beleuchtung. Nur die Musik der Sprache fehlt diesem Buche, um es zu einem Meisterstück der Memoirenliteratur zu erheben. Und merkwürdig: im selben Jahre 1913 erscheint des Sohnes Buch »Aus Indien« und enthält als wichtigstes Stück die Erzählung »Robert Aghion«, und es ist ebenfalls die Geschichte eines Missionars. Sie ist, mit den Kenntnissen des Vaters verglichen, einförmig und fast dürftig; aber sie hat Musik, sie hat jenes gewisse Etwas, das den Dichter vom Schriftsteller unterscheidet.
Aber weiter. 1914 publiziert der Vater in den Basler Missionsstudien eine Broschüre »Laotse, ein vorchristlicher Wahrheitszeuge«, und 1914 in einem durch den Krieg abgebrochenen Romanfragment »Das Haus der Träume« finde ich beim Sohne die ersten Spuren chinesischer Studien. Diese Studien treten dann in den »Märchen« und später im »Klingsor« stark hervor, um schließlich im »Kurzgefaßten Lebenslauf« bis zu jener lustigen Praktizierung des chinesischen Zauberbuches »I Ging« zu führen, nach dessen Anweisung der Verfasser in ein selbstgemaltes Eisenbähnchen steigt und sich chinesischerweise auf Nimmerwiedersehn empfiehlt.
1916 ist das Jahr, in dem des Dichters Vater in Kornthal gestorben ist. (...) Jetzt erst, von 1916 an, beginnt den Dichter die Lösung jenes andern großen Themas zu beschäftigen, das seine Kindheits- und Jünglingsjahre erfüllte: die Lösung des Verhältnisses zum Vater. Die Frucht ist, sechs Jahre später, der »Siddhartha«. Vorher aber muß (im »Demian« und im »Klingsor«) jene gerade vom Vater lange Zeit zurückgedämmte Welt eines triebhaft wuchernden Sinnen- und Gefühlslebens Gestalt geworden sein. (...)
Im »Siddhartha« sucht Hesse vor allem die Musik Indiens zu erfassen. Er trägt ihren Klang seit frühestem Kindergedenken im Ohr; diesen hieratischen Dreiklang, der den Satz gleich einem Sternbild tönen läßt, indem er dreimal dasselbe sagt, nur in anderer Wendung. Priesterlich tanzt und schreitet die Sprache, denn der Priesterschritt ist ein feierlicher Urtanz, und das Tänzerische ist dem Priester eigen. Ein wohlgefügtes Geschmeide ist diese Sprache, sorglich sind die Verschlüsse und Verschränkungen angebracht, und immer dort, wo ein Edelstein zu sitzen bestimmt ist, liegt eine Wunde darunter, die mit ihm verdeckt und verschlossen wird. So zieht sich kreuz und quer ein Goldgehänge und Silbergefüge über den Leib des Erleuchteten, des Buddha, dessen Gesicht alle Zeichen in sich verschlingt und in alle Zeichen sich auflöst. Und so kommt es, daß Gowinda zuletzt verwundert seines Freundes Siddhartha Gesicht nicht mehr sieht. »Er sah statt dessen andere Gesichter, viele, eine lange Reihe, einen strömenden Fluß von Gesichtern, von Hunderten, von Tausenden, welche alle kamen und vergingen und doch alle zugleich da zu sein schienen.«
Er sieht die Embleme, das Tempelgesicht, das Gesicht der Ruhe und der heiligen Zeichen; das Gesicht der Götter und des ewigen Kreislaufs. Alle diese Gesichte zusammen machen den Blick des Erleuchteten aus, dem die Sprache des Dichters wie ein phantastischer Kopfputz über die Schultern hängt. Diese Sprache ist im Schmelztiegel der Schmerzen flüssig gemacht und über dem Feuer des Schicksals geläutert worden. Es ist milder Goldglanz und blaue Emaille in ihr und ein feines metallisches Klirren. Und die Sprachkette ist gerafft zu vielen schwingenden Bogen, und alle sammeln sich über dem riesigen Haupte des Krischna, der über den Schlangen tanzt und der doch nur eines der Gesichte ist, die den Blick des Brahmanensohnes Siddhartha erfüllen. Denn dieser kommt von der Mutter her, und die Mutter trägt Götter wie Menschen im Schoß; sie ist der Strom und der ewige Kreislauf. (...)
Die Lehre des »Siddhartha«, wenn man davon sprechen will, führt vom Priesterhause weg an den Fluß, zum Natursymbol. Ob es ein indisches oder ein schweizerisches Paradies sei: immer doch ist es ein Naturparadies, nicht ein »geistiges«. Immer ist es das »Reich Gottes auf Erden«, und das Diesseits ist betont. Und da wie dort ist es der einzelne, der diese Welt vertritt; der sie sich im Gegensatze zu den andern, zu allen andern, erobern muß. Immer ist es ein Protestierender, ob er laut oder stumm protestiere. Immer sind es die greifbaren, die nächsten, die menschlichsten Dinge, die dem schönen Scheine erobert und in ihn aufgelöst werden sollen. Es gilt keine äußere Autorität, heiße sie Vater oder Gautamo Buddha; nur die Stimme des eigenen Innern gilt. Es gilt kein errungener Besitz und keine geprägte Form, mögen sie wie im »Camenzind« Zivilisation oder wie im »Siddhartha« Offenbarung heißen. An die harte Welt der Dinge soll die Liebe anknüpfen, nicht an Gedanken, die von den Dingen herkommen. Woher aber kommt die Liebe? Sie ist wohl eine Gnade, ein Urphänomen, wie die Dinge selbst voll der Gnade sind. Und nur wo Gnade und Gnade sich treffen, wo der brüderliche Einklang, wo die Möglichkeit einer Verwandlung des Steins in den Erleuchteten und des Erleuchteten in den Stein empfunden wird: nur dort ist für Siddhartha Gott. Oder besser: dort ist für ihn die ewige Mutter."
Hugo Balls Biografie erschien 1927 zu Hermann Hesses 50. Geburtstag und im Jahre der Veröffentlichung des Steppenwolfes. Hugo Ball starb im selben Jahr an einem Krebsleiden.
Ohne ein bisschen Werbung geht es nicht. Ich bitte um Nachsicht, falls diese nicht ganz themengerecht sein sollte.