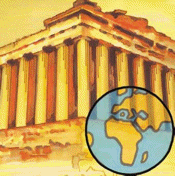

StD Wolfgang Winter
DS Barcelona 1986
Neubearbeitung:
Hölderlin-Gymnasium
Nürtingen 2004
3. Die Bildlichkeit
Früher wurde die Bildlichkeit zu den rhetorischen Figuren gerechnet. Es gibt jedoch Erscheinungen in der neueren Dichtung, die es als sinnvoll erscheinen lassen, die Bildlichkeit gesondert darzustellen. In vielen fiktionalen Texten spielt die Bildlichkeit eine besondere Rolle. Bei einer Interpretation stellt sich daher die Aufgabe, nicht nur die Bilder zu erkennen, sondern besonders aufmerksam zu interpretieren, was durch sie ausgesagt wird.
3.1 Das unmittelbare Bild
In einem unmittelbaren Bild wird ein Bild vor unseren Augen entworfen, meistens ein Bild der Natur, das Stimmung ausstrahlt und den Leser/Hörer unmittelbar gefühlsmäßig, weniger rational anspricht. Es findet also keine Übertragung von einem Bereich zum anderen wie bei der Metapher statt, sondern das unmittelbare Bild stellt etwas konkret vor unsere Augen.
Lieblich war die Maiennacht,
Silberwölklein flogen
aus: N. Lenau, „Der Postillon”
3.2 Mittelbare sprachliche Bilder
Diese Bilder heißen mittelbar, weil sie nicht selbst direkt etwas aussagen, sondern nur in Verbindung mit einer anderen Ebene.
3.2.1 Der Vergleich
Bei einem bildlichen Vergleich werden zwei Bereiche durch „wie” oder „als ob”miteinander verbunden. Die Verbindung ist möglich, da es einen Vergleichspunkt gibt, etwas Gemeinsames zwischen beiden Bereichen, das „tertium comparationis”.
Er kämpft wie ein Löwe.
3.2.2 Das Gleichnis
Das Gleichnis stellt eigentlich einen breit ausgeführten Vergleich dar.
Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon.
aus: Matthäus 13, 24ff
3.2.3 Die Metapher (Adj. metaphorisch)
Nach älterer Auffassung ist die Metapher aus dem Vergleich durch Weglassen von „wie” entstanden. In der Metapher werden zwei Bereiche unmittelbar und sehr intensiv miteinander verbunden.
der Strom des Lebens
Nach ihrer grammatischen Struktur gibt es unterschiedliche Metaphern:
Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen?
Was ist die Welt und ihre ganze Pracht?
.............................................................
ein schneller Blitz bei schwarz gewölkter Nacht.
aus: Christian Hofmann von Hofmannswaldau, „Die Welt”
3.2.3.1 Die Personifikation
Die Personifikation ist ein Sonderfall der Metapher: ein Ding oder ein Abstraktum werden als lebendiges Wesen gesehen., z.B. „Mutter Natur”.
3.2.3.2 Die Synästhesie
Auch die Synästhesie stellt einen Sonderfall der Metapher dar. In ihr werden zwei oder mehr Sinneseindrücke miteinander vermischt.
Hör, es klagt die Flöte wieder,
Und die kühlen Brunnen rauschen,
Golden wehn die Töne nieder ‑
Stille, stille, lass uns lauschen.
aus: Clemens Brentano, Abendständchen”
3.2.4 Die Chiffre
Die Chiffre erscheint in der modernen Lyrik. Sie ist ein Bild, das nicht so ohne weiteres zu klären ist, da es nicht auf allgemeingültige Vorstellungen zurückgeht und nicht realitätskonform ist. Häufig lässt sich die Bedeutung einer Chiffre nur aus dem Gesamtwerk eines Dichters erschließen.
.....................................
Silbern weint ein Krankes
Am Abendweiher,
Auf schwarzem Kahn
Hinüber starben Liebende.
aus: Georg Trakl
3.2.5 Die Metonymie
Das eigentliche Wort wird durch ein anderes Wort ersetzt, mit dem real eine Beziehung vorhanden ist. So war die Bezeichnung „der Kreml” eine Metonymie als Bezeichnung für die frühere sowjetische Regierung, da der Kreml der Sitz der sowjetischen Regierung war. Ein Schwarzer” ist in Deutschland eine metonymische Bezeichnung für einen Anhänger der als katholisch‑konservativ geltenden CDU: das schwarze Priestergewand ist der Ausgangspunkt für die Metonymie.
3.2.6 Die Synekdoche
Die Synekdocheist so ähnlich wie die Metonymie. Mit ihr wird meistens ein weiterer Begriff durch einen engeren bezeichnet („pars pro toto”).
Kein Hund kann so leben. (kein Lebewesen)
Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun,
das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun
hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret.
aus: Andreas Gryphius, Tränen des Vaterlands”