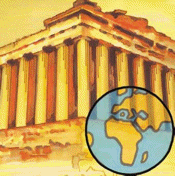

StD Wolfgang Winter
DS Barcelona 1986
Neubearbeitung:
Hölderlin-Gymnasium
Nürtingen 2004
Die Interpretation von fiktionalen und Analyse nicht-fiktionalen Texten haben vieles gemeinsam: Doch jede Textsorte weist auch Merkmale auf, die nur für sie spezifisch sind. Aus diesem Grunde wird auf den folgenden Seiten das dargestellt, was alle gemeinsam haben, dann wird auf die spezifischen Eigenschaften der unterschiedlichen Textsorten und Gattungen eingegangen.
In den letzten Jahren ist alles noch etwas komplizierter geworden, da es unter Umständen nicht nur darum geht, einen Text zu erfassen und ihn in einer Interpretation analytisch darzustellen, sondern ihn auch gestaltend zu interpretieren. Das bedeutet, das ein Aufsatzschreiber lernen muss, mit vielen der auf den folgenden Seiten dargestellten Mittel selbst aktiv umzugehen.
Bei der Analyse nicht-fiktionaler Texte muss ein Aufsatzschreiber vor allem herausfinden, wie der jeweilige Text den Leser zu erreichen versucht. Der appellative Charakter solcher Texte steht im Zentrum. Dies ist bei der Analyse von Werbetexten z.B. evident. Bei fiktionalen Texten kann die appellative Komponente z.T. völlig unwichtig sein. Stattdessen sind dort z.B. die besonderen Eigenschaften der jeweiligen literarischen Gattungen besonders wichtig. Deshalb ist es nötig, in dem jeweiligen Interpretationsaufsatz auf diese speziellen Merkmale einzugehen. Bei der Interpretation eines Gedichtes ist es z.B. unbedingt erforderlich, die spezifische äußere Form des jeweiligen Gedichts zu untersuchen, bei der Interpretation eines Prosatexts ist im Allgemeinen dagegen die Untersuchung der Erzählperspektive wesentlich. Folgende Aufsatzgattungen erscheinen seit dem Abitur 2004 :
1. Die Interpretation von Prosatexten
2. Die Gedichtinterpretation
3. Die Interpretation eines Dramas
II. Die Analyse und Erörterung nicht-fiktionaler Texte (z.B. von Werbung, Reden usw.)
In Baden-Württemberg werden bei den sogenannten Sternchenthemen” bei Themen aus der Epik oder der Dramatik im Allgemeinen drei Fragen zu den Texten gestellt. Die erste Frage dient meistens der Einordnung, die zweite Frage verlangt meistens eine genaue Analyse des Textes /der Texte, die dritte Frage geht über den Text hinaus und verlangt eine Einbettung in das Gesamtwerk/die Gesamtwerke, entweder analytisch oder auch gestaltend.
Trotz aller Unterschiede der Gattungen und Textsorten gibt es grundsätzliche Gemeinsamkeiten bei der Interpretation und Analyse von Texten. Dies gilt auch für das methodische Vorgehen. Folgende Arbeitsschritte sind notwendig:
i. Erste Lektüre des Textes:Inhaltliche Analyse: Aufbau des Textes, auftretende Personen, Ort/Zeit, auffallende inhaltliche Gesichtspunkte, Aussageabsicht des Autors sprachliche Analyse: Syntax, Wortarten, Bildlichkeit, rhetorische Figuren, Sprachebenen usw.. In kaum einem Text sind all diese Gesichtspunkte relevant. Je nach Beschaffenheit des Textes ist der eine oder der andere Gesichtspunkt auffallender oder besitzt mehr Gewicht. Folgendes ist unbedingt zu beachten: Es reicht nicht aus, wenn man z.B. nur feststellt, dass der Autor des Textes bestimmte Wortarten verwendet, sondern es muss auf jeden Fall untersucht werden, welche Wirkungen erreicht werden und zwar bezogen auf den konkreten Text. Um dies zu verdeutlichen, sei das Vorgehen eines Arztes bei einer Diagnose als Vergleich angeführt: Wenn der Arzt festzustellen versucht, was für eine Krankheit ein Patient hat, sammelt er zunächst alle möglichen Symptome und wertet dann diese Symptome aus. Je mehr Symptome er findet, desto leichter ist es für ihn, sie auszuwerten und zu einer richtigen Diagnose zu kommen. Ähnlich ist es bei einer Interpretation: Das, was man findet und was feststellbar ist (z. B. der Gebrauch von bestimmten Wortarten), muss im Hinblick auf die Aussage des Textes ausgewertet werden. Es empfiehlt sich daher, nach folgendem Schema vorzugehen:
| Befund | Auswertung |
|---|---|
........................................................................... ........................................................................... |
........................................................................... ........................................................................... |
Das Verfahren b) ist grundsätzlich schwieriger. Es ist vor allem bei längeren Texten notwendig, um Wiederholungen zu vermeiden. Man muss dabei genau wissen, welche Gesichtspunkte für die Interpretation des jeweiligen Textes wesentlich sind. Meistens wird diese Aufgabe durch die schon erwähnten Arbeitsanweisungen zu erleichtert. Diese sollten jedoch nicht als Anweisung, drei Mini-Aufsätze zu schreiben, missverstanden werden. Der Aufsatz bildet ein zusammenhängendes Ganzes. Das Verfahren a) kann bei der Interpretation von kürzeren, sehr schwierigen Texten sinnvoll sein, in denen es auf jedes Wort ankommt. Das gilt für viele Gedichte, zumal bei mehrstrophigen Gedichten die einzelnen Strophen häufig Sinnabschnitte darstellen. Bei diesem Verfahren besteht die Gefahr, dass es zu Wiederholungen kommt oder dass der Text nicht als Ganzes beachtet wird. Häufig ergibt sich auch eine „Erlebnisinterpretation”, in der die Aufnahme des Gedichts oder Prosatextes beim Leser nachgezeichnet wird. Eine Formulierung wie „und jetzt” ist sehr verräterisch und unbedingt zu vermeiden!
Um zu einer fundierten Interpretation zu kommen, die nicht nur inhaltliche Gesichtspunkte berücksichtigt, sollte man die Grammatik gut beherrschen, bei der Beschäftigung mit deutschen Texten also die deutsche Grammatik. Das bedeutet, dass man zunächst Grammatikphänomene erkennt und benennt und sich dann überlegt, ob sie etwas über den zur Interpretation vorliegenden Text aussagen. Besondere Bedeutung hat die Kenntnis der Wortarten und ihrer Funktionen und der Syntax. Denn wenn in einem Text bestimmte Wortarten besonders häufig und in auffallender Weise verwendet werden, so kann dies schon viel über ihn aussagen. Außerdem verwenden viele Schriftsteller die normale Grammatik in ungewöhnlicher und unüblicher Weise. Sie „spielen” sozusagen mit den Möglichkeiten der Sprache und den normalen grammatischen Regeln und gehen somit mit der Sprache anders um, als wir es in der Alltagskommunikation tun, weil sie bestimmte Effekte und Wirkungen erreichen wollen. Das kann man gut an einem Beispiel aus einem anderen sprachlichen Gebiet illustrieren: In der Alltagskommunikation sprechen wir nicht in Jamben und Trochäen, selbst wenn wir es könnten. Was würde wahrscheinlich auch mit dem passieren, der es ständigtäte? Viele Dichter benutzen jedoch diese Möglichkeit der Sprache, ohne Gefahr zu laufen, für verrückt erklärt zu werden. In ähnlicher Weise gehen sie häufig gegen die normale Grammatik sehr unkonventionell mit der Sprache um.
Allerdings wird sehr selten davon die deutsche Grundgrammatik (Artikel, Deklination, Konjugation usw.) berührt, da sonst die Kommunikation erschwert oder unmöglich wird. Es gab jedoch in manchen Epochen der Literaturgeschichte auch Experimente in dieser Richtung. Auch in der Gegenwart kommen sie vor und führen bis zur Erfindung einer neuen Sprache. Solche nicht‑grammatischen Texte sind jedoch eher die Ausnahme. Am häufigsten werden die
Möglichkeiten genutzt, die die Syntax und die einzelnen Wortarten bieten, zumal der Charakter der deutschen Sprache grundsätzlich einen Wortklassenwechsel erlaubt (vgl. die Substantivierung von Verben und Adjektiven).