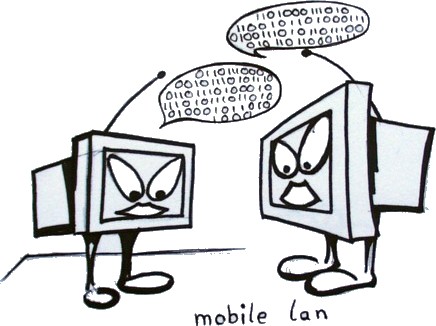Als die Nainablabla-Debatte („ich hab keine Ahnung von Steuern …“) die Wochenzeitung Die ZEIT erreichte, habe ich mich gefreut und gehofft, dass ich jetzt das Thema niveauvoll in meinen Deutschkurs tragen könnte. Dann las ich Ulrich Greiners Plädoyer für das Schöne und den Nutzen der vermeintlich nutzlosen Fächer (22. Januar) und beschloss: So geht es doch nicht, man kann den Deutschunterricht nicht dadurch rechtfertigen, indem man ihn zum Orchideenfach erklärt und dann ein bildungsbürgerliches Schutzgehege drumherumwickelt.
Zweite Hoffnung: Eine Woche später (29.1.) antwortet ein „Harvard-Dozent“. Der Leser erwartet Bedeutendes: Harvard! US-Elite-Uni! Der weiß Bescheid!
Doch dann folgen zuerst einmal einige Erinnerungssplitter aus dem damaligen Deutschunterricht: Einmal sollte man nur Gebrauchsanweisungen schreiben („schlimm“!), ein ander Mal musste man Schillers „Glocke“ auswendig lernen (noch „schlimmer“!) – man fragt sich: Wann und wo ist der Autor in Deutschland in die Schule gegangen? (Antwort: „München“).
Dann kommt die Überraschung: Beides ist falsch! Weil es sich immer noch um das passive „Aneignen“ und „Wiederkäuen“ von Fakten handele. Ja, wenn Schule so funktioniert, dann hat er schon irgendwie recht. Aber wo und wann passiert das noch in dieser Weise? Wer von unseren Schülern hat zuletzt die „Glocke“ auswendig lernen müssen? In welchem Bundesland, in welchem Schultyp, nach welchem Bildungsplan? In München?
Ich bin enttäuscht: Kein besonders starker Ausweis von argumentativer Redlichkeit, zuerst ein Zerrbild von Schule zu zeichnen, daraus eine allgemeine Zustandsbeschreibung des Bildungssystems abzuleiten und dieses dann zum Irrweg zu erklären. Und überhaupt: Allgemeinbildung spiele in Deutschland eine „zu wichtige Rolle“, sie werde „überschätzt“. Die Lösung müsse lauten: „analytisches Denken“ statt „sinnentleertes Faktensammeln“.
Und nun folgt das unausweichliche Lob der angloamerikanischen Universitäten: Während bei uns nur „bekannte Fakten“ aufgezählt werden, werden dort „eigene Argumente aufgebaut“. So ist das in Cambridge. Und erst recht in Harvard: Dort kompensieren die Studenten ihr fröhliches Nichtwissen mit Neugier und Intelligenz. Nach drei Monaten schon schreiben sie einen Essay, „der eine originelle Meinung fundiert vertritt“. (S. 64)
Ich fasse zusammen (ziemlich fassungslos): Wissen ist ein Kreativitätshemmnis, Wissen behindert die Meinungsbildung, Wissen macht überheblich, aber nicht neugierig!
Und wieder haben wir das Entweder-Oder und nichts dazwischen. Kommen wir in der Bildungsdebatte auf diesem Niveau weiter? Ich möchte dem ein wenig nutzlose Bildung entgegenstellen und zwar die gute alte Matthäus-Formel: „Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.“ (Matthäus 25,29) In leichtem Deutsch heißt dies: Von nichts kommt nichts oder: wo nichts ist, kann auch nichts werden oder: wer nichts weiß, lernt auch nichts dazu.
Ich behaupte: Die Rolle des Wissens (und damit des Wissenserwerbs) wird unterschätzt. Wer sich in einer Fremdsprache unterhalten will, dem nützt es wenig, wenn er weiß, wo das gesuchte Wort steht (im Smartphone natürlich), es wäre besser, er hätte es vorher gelernt. Und wer den Benzinverbrauch seines Fahrzeuges wissen will, der hat es einfacher, wenn er den Dreisatz beherrscht, vom kleinen Einmaleins ganz zu schweigen. Und wer Auto fährt, der tut gut daran, die Verkehrsregeln nicht erst nachschlagen zu müssen.
Lässt sich das auch auf Allgemeinbildung anwenden? Ja, man kann z.B. ganz gut leben, ohne den Seneca zu kennen, für die seelische Befindlichkeit könnte etwas stoische Gelassenheit aber ganz zuträglich sein.
Die Debatte muss also weiterhin die Frage nach dem nützlichen Wissen stellen und nicht den Nutzen von („Fakten“-)Wissen in Frage stellen. Dabei darf es auch ein bisschen Allgemeinbildung sein, sonst bleibt alles nur Blabla.