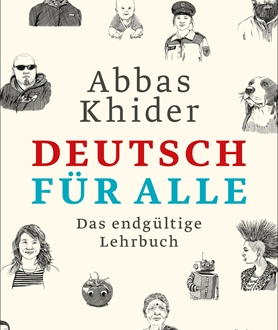Abbas Khider träumt davon, die deutsche Sprache zu erneuern. Dafür gibt es viele gute Gründe. Abbas Khiders Grund ist seine Biographie: Er kam aus dem Irak nach Deutschland, als Flüchtling, vor zwanzig Jahren, und er hat seitdem – so jedenfalls schildert er es – nichts anderes angestrebt, als die deutsche Sprache in Wort und Schrift perfekt zu beherrschen. Dafür hat er viele Umwege, Aushilfsjobs und bürokratische Hürden in Kauf genommen, um schließlich einen Magister in Vergleichender Literaturwissenschaft und Philosophie an der Uni München zu erringen.
Das war ein Jahrzehnte währender Kampf mit einem „Ungeheuer” (S. 19), den er letzten Endes gewonnen hat. Aber: Er möchte diesen Kampf den vielen anderen, die – aus welchem Grund auch immer – deutsch lernen wollen/müssen, ersparen. Die deutsche Sprache muss vor allem vereinfacht werden, damit die Integration funktioniert (S.36).
Diesem ehrenwerten Ziel ist das Buch „Deutsch für alle“ gewidmet. Abbas Khider formuliert sein Vorhaben so:
„Ich möchte … kleinere Bereiche dieser Sprache, ihres Vokabulars und ihrer Grammatik teils erneuern, teils reformieren, sogar einiges neu erfinden. Ich will, dass in Zukunft keiner mehr das Gejammer von mir und meinesgleichen ihretwegen hören muss … Es soll möglich sein, genau so schnell Deutsch zu lernen wie Englisch. „(S. 24/25)
Abbas Khider untertreibt: Was er an Vorschlägen unterbreitet, ist weder klein noch bescheiden, es geht im Grunde um alles: Um die Geschlechter (Genera), die Zeiten (Tempora), Deklination, Satzbau und Wortstellung (Syntax) – und nicht zuletzt um die verflixten Umlaute, jene „phonetischen Tretminen“ (19), die dafür verantwortlich sind, dass Abbas Khider auch nach zwanzig Jahren „sofort als Fremder identifiziert werden kann“ (S. 20). Darum sei er im Übrigen ein deutscher Schriftsteller geworden: „Beim Schreiben hört man meinen Akzent nicht“.
Im Einzelnen schlägt er vor:
- die „Autorität des Artikels“ in Frage zu stellen und aus drei Genera eines zumachen: statt der-die-das nur noch de
- den Genitiv abzuschaffen und durch die bayerische von-Form zu ersetzen
- die Deklination und die Konjugation auf wenige Formen zu reduzieren
- die unterschiedliche Wortstellung in Haupt- und Nebensätzen anzugleichen (für Fachleute: es geht um die Verb-Endstellung in subordinierten Nebensätzen, die z.B. mit weil beginnen) (S. 52)
- unregelmäßige Verben sollen regelmäßig werden (S.99)
- alle trennbaren Verben werden untrennbar
- und schließlich werden die Umlaute und das ß aus dem Alphabet gestrichen (116)
Die Sätze, die auf diese Weise zustande kommen, klingen dann z.B. so:
„E Flüchtling redet in de Botschaft mit e Mitarbeiter und e Mitarbeiterin über de Visum.“
„Ali Baba hat bestanden de Prüfung, weil er versteht de deutsch Nebensatz.”
… de Buch von de Mann / e Buch von e Mann
„An de Sonntag gegen 6 Uhr de Kind aufwacht. Es aufweckt sein Vater.”
Bis auf das letzte Beispiel könnte man sich an das Deutsch erinnert fühlen, das man auch sonst hört und manchmal auch liest. Abbas Khiders Neudeutsch klingt oft genug nach dem neuesten Deutsch der Straße. Beim Lesen von diesem Neudeutsch könnte einen aber auch das Gefühl beschleichen, dass das neue Deutsch von dem Khider eine Beleidigung des guten Deutsches bzw. der gutes Deutsch sprechenden Deutschen ist. Es soll auch zu Shitstorms gekommen sein. Dabei gibt es eine Vorbemerkung, die dem eigentlich vorbeugen könnte: „Dieses Büchlein ist ernsthafter sprachwissenschaftlicher Schwachsinn.“ (S. 10)
Warum sollte man dann ein solches Buch kaufen und lesen?
• Erstens, weil es einen Blick von außen auf unsere Sprache erzwingt.
• Zweitens, weil es die enorme Lernleistung erkennbar macht, die von Migranten und anderen Zugereisten erwartet wird.
• Und drittens: Khider erzählt wunderbare Geschichten aus seinem Leben: als Flüchtling, als Student oder als Neudeutscher.
Hier einige Kostproben:
Das wohltemperierte Deutsch: „Als ich in der Bundesrepublik ankam, kannte ich lediglich drei deutsche Wörter: Hitler, Scheiße und Lufthansa. Das sind international bekannte Begriffe.“ (S.11)
Das Taiwanesische im deutschen Satzbau: „Im Ausland haben die deutschen Baufirmen einen guten Ruf, auch die deutschen elektronischen Geräte. Alles aus Deutschland ist stabil gebaut und hält lange, denkt man zum Beispiel im Irak, aber auch in anderen arabischen Ländern.“ (S.45)
Die Verteidigung der langen Unterhose: „Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich noch nie in meinem Leben Minustemperaturen erlebt. … Zu jener Zeit habe ich auch den Typen gehasst, der einmal zu mir sagte: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.“(S. 78)
Die Präpositionen von Allah: „Als Jugendlicher war ich ein Jahr lang religiös. Ich muss so vierzehn Jahre alt gewesen sein. Es begann alles mit …“ (S. 85)
Wie diese Geschichten weitergehen, wird nicht verraten.
Abbas Khider ist nicht der erste, der sich liebevoll respektlos mit der deutschen Sprache auseinandersetzt. Er steht in den Fußstapfen des Amerikaners Mark Twain, der 1880 in seinem Aufsatz The awful German language Vorschläge zur Vereinfachung der deutschen Sprache gemacht hat. Auch diese sind humoristisch gemeint, auch sie zeigen erstaunliche Einsichten in die Stolpersteine des Deutschen. Allerdings war Mark Twain kein Flüchtling, sondern Bildungsreisender. Und zu seinem Glück gab es damals kein Internet und das Wort „shitstorm“ schon gar nicht.
P.S.: Der Untertitel des Buches lautet „Das endgültige Lehrbuch„. Der Duden gibt für „endgültig“ als Synonym u.a. „unwiderruflich” an und verweigert dem Wort die Steigerungsform – nicht ohne eine gewisse Logik. Mit Khiders Neudeutsch ist in der Tat eine grammatikalische Endstufe erreicht, hinter die nicht weiter gegangen werden kann. Damit hätte sich Deutsch dem Englischen stark angenähert und Englisch ist ja schließlich die Weltsprache schlechthin. Deutsch, so einfach wie Englisch, das könnte nicht nur bei der Integration helfen, sondern auch die Attraktivität des Investitionsstandortes BRD stärken. Ist das jetzt „ernsthaft” oder „Schwachsinn”?
Klaus Dautel
Deutsch für alle. Das endgültige Lehrbuch. Hanser Verlag 2019, 120 Seiten, 14 Euro – Hier eine Leseprobe (pdf)