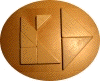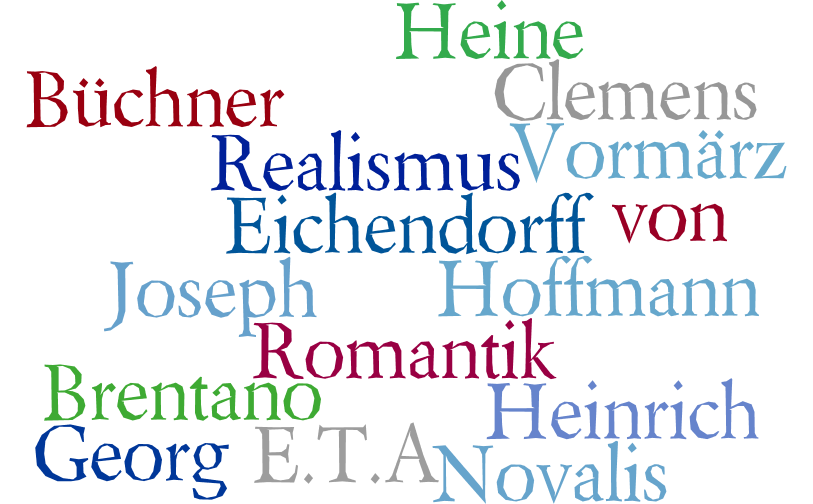
Romantik, Vormärz, Realismus ...
K. Dautels Ideen, Materialien und Vorschläge für den Deutschunterricht
Die Materialien stehen unter der Creative Commons Lizenz: CC BY 4.0.

2. LYRISCHES INTERMEZZO (1821-22)
Aufbau bzw. Entwicklungsgang des Zyklus!
3. HEIMKEHR (1823-24)
4. Aus der HARZREISE (1824)
5. NORDSEE (1825-26)
ZUSÄTZE
 „Fragen” - „O löst mir das Rätsel des Lebens” → „und ein Narr wartet auf Antwort” (Bausteine einer Interpretation)
„Fragen” - „O löst mir das Rätsel des Lebens” → „und ein Narr wartet auf Antwort” (Bausteine einer Interpretation)
 Zwischen den Stühlen: Einordnungen
Zwischen den Stühlen: Einordnungen
 Ironie, Satire, Übertreibung: Stilmittel
Ironie, Satire, Übertreibung: Stilmittel
(cc) Klaus Dautel