Die
Gezeiten
Das Leben
an der Nordseeküste wird bestimmt durch die Gezeiten, d.h. Ebbe
und Flut.
Was sind Ebbe und Flut, wie
entstehen sie?
Ebbe
und
Flut,
die Gezeiten oder auch Tiden genannt, sind Niedrigwasser und
Hochwasser. Bei Niedrigwasser, der Ebbe, läuft das Wasser aus dem
Wattenmeer ab, bei Flut kehrt es zurück. Wenn das bei Flut in das
Watt
zurückströmende Wasser seinen höchsten Stand erreicht
hat, spricht man
von Hochwasser. Hat es bei Ebbe seinen tiefsten Stand erreicht, spricht
man von Niedrigwasser. Als Tidenhub bezeichnet man den Unterschied
beider Wasserstände.
|
Wie
entstehen nun Ebbe und Flut?
Ebbe und
Flut,
d. h. das Absinken und Ansteigen des Meeresspiegels, hängt mit der
Anziehungskraft des Mondes und
der Fliehkraft zusammen. Der Mond
übt
auf die Erde eine Anziehungskraft aus, die bewirkt, dass zwar nicht das
Festland, wohl aber die Wasserteilchen der Weltmeere bewegt werden. Es
entsteht ein „ Flutberg“, der mit dem Mond um die Erde wandert. Deshalb
sind auch Ebbe und Flut nicht überall auf der Nordhalbkugel
zeitgleich.
Sie wechseln aber in regelmäßigen zeitlichen Abständen,
alle 12Std und
25min. Der Tidenhub ist auch
nicht überall gleich, er beträgt
z.B. bei
Wilhelmshaven 3m, in London 7m und in Nordfrankreich bei Malo 14m.
 :
|
|
Deiche
schützen das Land
Große
Sturmfluten, sowie die
noch gefürchtetere Springflut,
„der Blanke
Hans“, gefährden Mensch und Vieh.
Ist das Hochwasser besonders
hoch,
sei es, dass bei Ebbe das Wasser nicht ganz abgelaufen ist oder extrem
starke Stürme große Wellen landeinwärts treiben,
spricht man von einer
Sturmflut.
So haben im Jahre 1962 orkanartige
Stürme an der
Nordsee
tagelang die Wassermassen in die Flussmündungen
hineingedrückt, so
dass das Wasser bei Ebbe nicht mehr ablaufen konnte. Der Wasserspiegel
war also mit beginnendem Hochwasser schon sehr hoch. Die Flutwelle
reichte bis nach Hamburg und zerstörte viele Deiche im Elbbereich.
Über
300 Menschen verloren ihr Leben.
Eine
Springflut
entsteht, wenn eine starke Flut bei Voll – oder Neumond eintritt. Oft
mehrere Meter hohe Wellen bedrohen dann Inseln und Festland. In der
Geschichte Frieslands haben Sturmfluten früher, bevor die Menschen
es
lernten sich und ihre Habe durch Deiche zu schützen, große
Schäden
angerichtet und viele Menschen-leben gefordert.
Bei der „Großen
Mandränke“ am 16.01.1362 verloren 10.000 Menschen ihr
leben, 30
Dörfer
verschwanden. Dabei soll auch die sagenhafte Stadt „Rungholt“
untergegangen sein. In diesem Gebiet dehnt sich heute das Watt.
Im
Jahre 1962 fanden Forscher hier Siedlungsreste, z. B. Teile von
Deichen, Geräte, sogar Ackerfurchen.
Die
in
diesem
Gebiet siedelnden Menschen schützten ihr Hab und Gut und sich
selbst
anfangs durch die Errichtung von künstlichen Erdhügeln, sog.
Warften
oder Wurten. Doch der immer weiter steigende Meeresspiegel zwang sie
dazu, diese Erdhügel immer weiter zu erhöhen.
Etwa
gegen
Ende
des ersten Jahrtausends begann man in dieser Region Deiche zu bauen.
Zuerst verband man einzelne Wurten
miteinander, indem man Reihen von
Holzpfählen einschlug oder Erddämme errichtete Die Erfindung
der
Sieltore ermöglichte es dann, bessere Deiche zu bauen und vor
allem
das Land hinter dem Deich besser vor Flut zu schützen und bei Ebbe
zu
entwässern. Sieltore schließen
sich bei Flut, das Wasser
drückt
dagegen, und öffnen sich bei Ebbe, so dass das Wasser
abfließt.
Aussehen,
Form
und Höhe der Deiche haben sich im Laufe der Geschichte stark
verändert,
musste man doch die Höhe der Deiche dem immer stärker
steigenden
Meeresspiegel anpassen. Betrug die Höhe der Deiche um 1600
ca.4,50m, so
weisen die heutigen modernen Deiche eine Höhe von 8,50m auf. Die
Deichhöhe wird heute so gewählt, dass nach menschlichem
Ermessen selbst
bei schwerer Sturmflut die Deichkrone nicht mehr überspült
wird. War
die Seeseite der Deiche anfangs sehr steil, so verläuft sie heute
viel
flacher. Der heutige Deich bietet den ankommenden Wellen weniger
Widerstand, diese laufen sich
„tot“.
|

By Original authors (see source) and Angelboer at da.wikipedia [Public
domain], via Wikimedia Commons

-
By Gerhard Pietsch (Privatarchiv von Gerhard Pietsch, Hamburg) [GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Deich auf Amrum, Seeseite (Foto: Erika Schuchardt) |
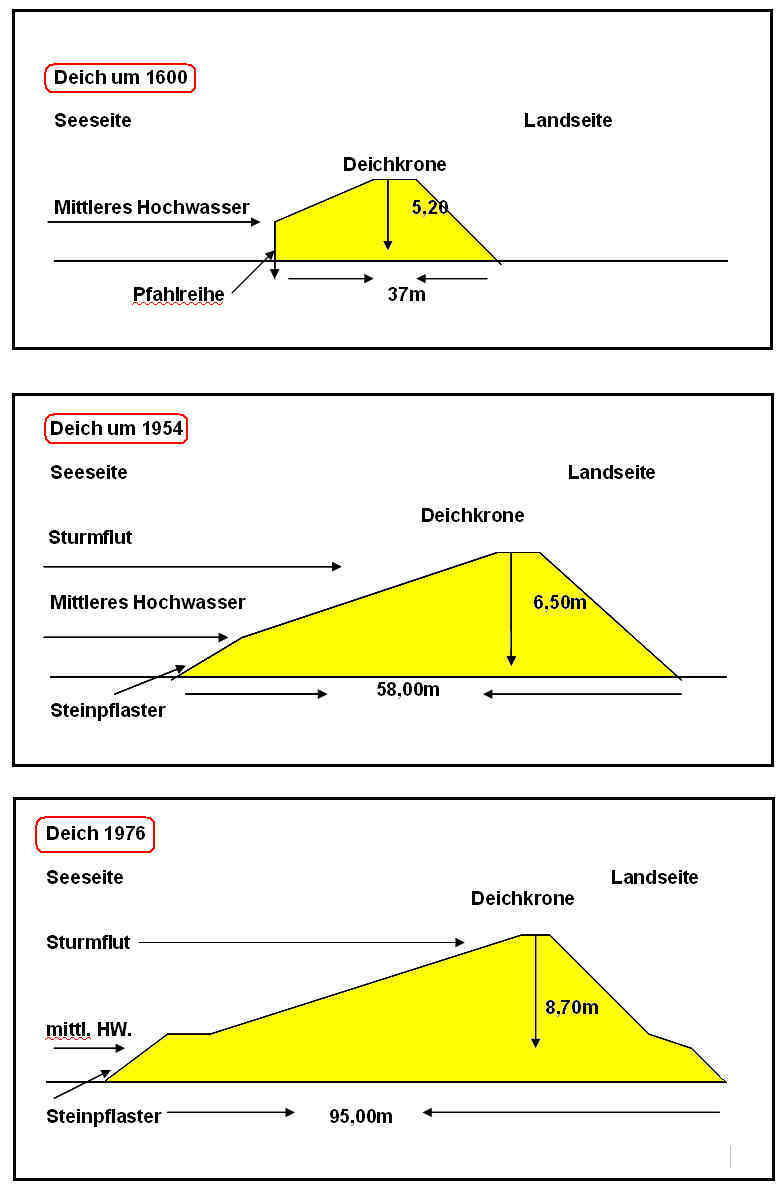
Deichquerprofilie
zu verschiedenen
Zeiten.
Zeichnung: Erika Schuchardt nach Vorlagen
|
Das beim
Deichbau verwendete Material hat sich im Laufe der Zeit geändert.
Zu
Beginn des Deichbaues verwendete man Klei (fester Schlick). Heute wird
zuerst ein Sandkern aufgeschüttet und befestigt. Darüber
kommt eine
Schicht Klei. Auf den unteren Teil des Deiches an der Seeseite werden
Grassoden gelegt, damit der Deich vom Meer nicht angegriffen werden
kann. Auf den anderen Teilen des Deiches wird Gras angesät, das
dann,
wenn es zu einer festen Grasdecke verwachsen ist von Schafen immer kurz
gehalten wird. Auf die Deichkrone wird manchmal eine Teerdecke
aufgebracht oder es werden Beton-platten verlegt, um einen Fahrweg zu
haben. Häufig verläuft auch ein Weg am Fuße des Deiches
an der
Landseite. Der Deichfuß an der Seeseite entlang wird
außerdem noch mit
großen Steinen,
z. B. aus
Basalt, gegen das angreifende Meer geschützt.
Zwischen
Inseln und dem Festland liegt das Wattenmeer
Das Watt
ist ein
flaches Gebiet, das sich von den Ostfriesischen Inseln vor der
Küste
Niedersachsens bis zu dem Nordfriesischen Inseln vor der Küste
Schleswig –Holsteins über eine Entfernung von 450 km erstreckt. Es
ist
durchschnittlich 7-10km breit. Der Wattboden besteht aus Schlick oder
aus Sand und ist von vielen Prielen durchzogen,
die, wenn man sie aus
der Luft betrachtet, wie Wasserläufe aussehen. Viele der
großen Priele
sind tief und haben oft eine sehr starke und gefährliche
Strömung. Da
das Watt ein ökologisch wertvoller Lebensraum ist, wurde ein Teil
zum
Nationalpark Wattenmeer erklärt |

Deichfuß mit Basaltsteinen befestigt
Deich am
Watt auf Amrum (Foto: Erika Schuchardt) |




