|
 Die Erinnerung an Friedrich den Großen boomt – und
das nicht nur im Jahr seines 300. Geburtstags. Auch wenn
die Intensität der Erinnerung Konjunkturen unterlag,
ist Friedrich II. von Preußen seit seinem Tod am
17. August 1786 in der Öffentlichkeit präsent
geblieben. Von jeher war er ein König mit Breitenwirkung,
der auf vielfältige Art und Weise erinnert und instrumentalisiert
wurde: Friedrich II. von Preußen – genannt „der
Große“ – gehört zu den markantesten
Persönlichkeiten der deutschen Geschichte und Erinnerungskultur.
Er galt als der erste Diener des Staates und Philosoph
auf dem Thron, wurde als volksnaher „Alter Fritz“ verklärt
und als Feldherr und Nationalidol verherrlicht, später
als Kriegstreiber und Menschenverächter an den Pranger
gestellt. Die Erinnerung an Friedrich den Großen boomt – und
das nicht nur im Jahr seines 300. Geburtstags. Auch wenn
die Intensität der Erinnerung Konjunkturen unterlag,
ist Friedrich II. von Preußen seit seinem Tod am
17. August 1786 in der Öffentlichkeit präsent
geblieben. Von jeher war er ein König mit Breitenwirkung,
der auf vielfältige Art und Weise erinnert und instrumentalisiert
wurde: Friedrich II. von Preußen – genannt „der
Große“ – gehört zu den markantesten
Persönlichkeiten der deutschen Geschichte und Erinnerungskultur.
Er galt als der erste Diener des Staates und Philosoph
auf dem Thron, wurde als volksnaher „Alter Fritz“ verklärt
und als Feldherr und Nationalidol verherrlicht, später
als Kriegstreiber und Menschenverächter an den Pranger
gestellt.
Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum nimmt
den 300. Geburtstag des Preußenkönigs zum Anlass,
um erstmals einen umfassenden Blick auf das Nachleben Friedrichs
in Kunst, Politik und Gesellschaft zu werfen. Sie veranschaulicht
auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern die wechselvolle
Rezeptionsgeschichte des Herrschers und geben einen unterhaltsamen
und spannenden Einblick in die preußisch-deutsche
und europäische Erinnerungskultur. Zum ersten Mal
steht damit das wechselvolle Nachleben des Preußenkönigs
in Kunst, Politik und Gesellschaft im Mittelpunkt einer
großen Ausstellung.
Die Präsentation „Friedrich der Große – verehrt,
verklärt, verdammt …“ zeichnet die Entstehungsgeschichte
des „Mythos Friedrich“ nach: den Aufstieg von
der Anekdotenfigur zum preußischen Denkmalhelden,
die Verklärung zum deutschen Nationalsymbol im Kaiserreich,
die Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten sowie die
Verdammung und vorsichtige Wiederentdeckung nach 1945.
 In dreizehn thematisch gegliederten Räumen zeigt
die Ausstellung, dass das Leben Friedrichs des Großen
in den mehr als 200 Jahren seit seinem Tod immer wieder
zum Bezugspunkt für politische Interessen wurde: Im
Vormärz sahen Liberale in ihm den aufgeklärten
Herrscher, Konservative hingegen die Verkörperung
preußischer Tugenden. In dreizehn thematisch gegliederten Räumen zeigt
die Ausstellung, dass das Leben Friedrichs des Großen
in den mehr als 200 Jahren seit seinem Tod immer wieder
zum Bezugspunkt für politische Interessen wurde: Im
Vormärz sahen Liberale in ihm den aufgeklärten
Herrscher, Konservative hingegen die Verkörperung
preußischer Tugenden.
Im Kaiserreich avancierte er zur deutschen Nationalikone,
in der Weimarer Republik zum Vertreter alter Werte und
fester Ordnung und im Zweiten Weltkrieg stilisierte ihn
die Propaganda zum unbeugsamen Schlachtensieger. Nach 1945
wurde der Preußenkönig in der Bundesrepublik,
der DDR und einigen europäischen Nachbarländern
vielfach als Kriegstreiber verdammt, später weckten
seine intellektuellen und künstlerischen Qualitäten
das öffentliche Interesse.
Neben dieser politischen Komponente verdeutlicht die Schau
aber auch die Präsenz Friedrichs des Großen
im Alltagsleben immer breiterer Bevölkerungsschichten:
Einzelne Räume zeigen Friedrich als Werbeikone, als
Sammelfigur und als dekoratives „Idol im Wohnstubenformat“.
Zahlreiche Medienstationen veranschaulichen seine Karriere
als Bühnenheld und Filmstar und bringen den Musiker
Friedrich zu Gehör.
450 Exponate aus dem In- und Ausland, die zum großen
Teil erstmals der Öffentlichkeit präsentiert
werden, entfalten ein facettenreiches Erinnerungspanorama,
das den Mythos des Preußenkönigs analysiert
und zeigt: Das Nachleben Friedrichs des Großen ist
ein multimediales Ereignis.
Bilder im Text:
Friedrich der Große – Mit Dreispitz in der
Hand grüßend.
Werkstatt Heinrich Franke,
um 1780
Berlin, DHM.
Foto: Sebastian Ahlers (oben)
Wahlplakat der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP): "Rettet
mir mein Preußen!"
Heinz Wever / Verlag der Deutschnationalen Schriftenvertriebsstellen
GmbH.
Berlin, 1932
Berlin, DHM.
Foto: Angelika Anweiler-Sommer (unten)
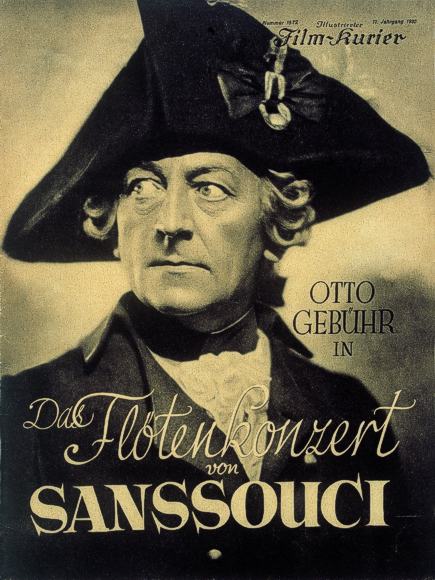
Filmzeitschrift zu dem Ufa-Spielfilm »Das
Flötenkonzert von Sanssouci«
August Scherl GmbH / Film-Kurier GmbH,
Berlin 1930
Berlin, DHM.
Foto: Angelika Anweiler-Sommer
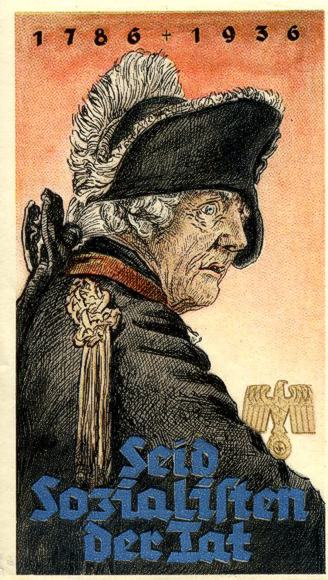
»Seid Sozialisten der Tat« Türplakette
des Winterhilfswerkes der NSDAP 1936
Berlin, DHM.
Foto: Angelika Anweiler-Sommer
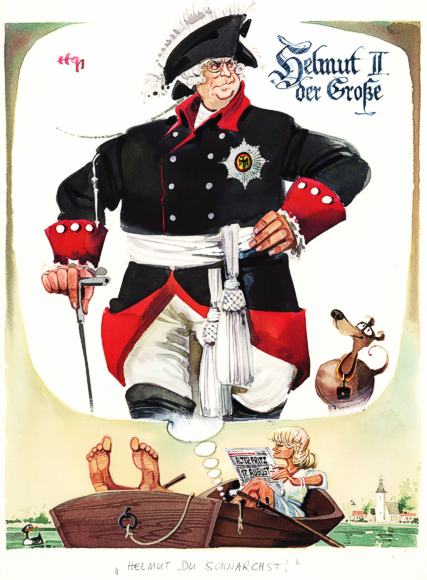
»Helmut II. der Große« – Karikatur
auf die Umbettung Friedrichs des Großen
Horst Haitzinger,
München 1991
München, Horst Haitzinger
|